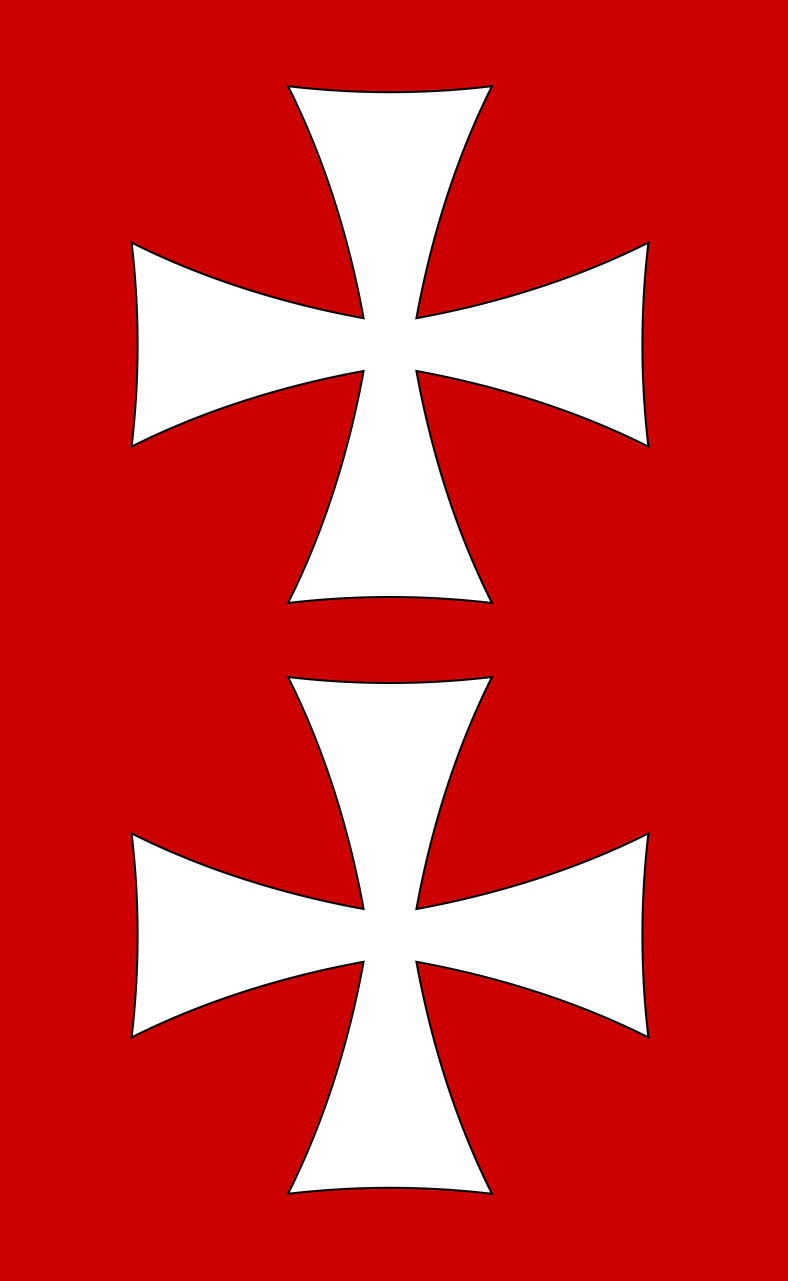Dr.Jo – 2022
“If people do not believe that mathematics is simple, it is only because they do not realize how complicated life is.” JvN
Einführung
John von Neumann (im Folgenden JvN) war sicherlich der Mathematiker des 20. Jahrhunderts mit dem größten Einfluss jenseits der Mathematik. Geboren 1903 in Budapest, formulierte er bereits als Vierundzwanzigjähriger in Göttingen die mathematischen Grundlagen zur Quantenmechanik. Er war Ehrenmitglied der Eötvös Gesellschaft. Er wurde Professor am Institute for Advanced Studies in Princeton, wo er den programmierbaren Elektronenrechner entwarf. Er ist der Begründer der modernen Spieltheorie. Er erhielt als Erster die Fermi Medaille (des AEC für Beiträge zur Entwicklung des Elektronenrechners ) und 1956 die Medal of Freedom von Präsident Eisenhower. Vgl. dazu [1]. Er bekam zwei Presidential Awards.
Neben seinen herausragenden Leistungen in der Mathematik und ComputerArchitektur hat JvN wichtige Beiträge zur Physik (Quantenmechanik), zur Meteorologie (Strömungsdynamik) und zu den Wirtschaftswissenschaften (Spiel theorie) geliefert. Während des 2. Weltkrieges wirkte JvN ab 1944 im “Manhattan-Project” mit. Durch die dabei anfallenden aufwendigen Berechnungen wie auch durch seine anderen Forschungsarbeiten (Hydrodynamik) war er auf die ersten großen Computer gestoßen, die zu der Zeit in Relais oder Röhrentechnik arbeiteten und mühsam durch das Stöpseln von Kabeln programmiert werden mußten. Sein wesentlicher Beitrag auf diesem Gebiet war die Entwicklung einer universellen ComputerArchitektur (“vonNeumannArchitektur”), die bis heute z.B. im Personalcomputer wiederzufinden ist. In seinen letzten Lebensjahren in Princeton war JvN als Berater in wichtigen politischen und wissenschaftlichen Gremien tätig. Er starb am 8. Februar 1957 in Washington D.C. mit 53 Jahren an Krebs, den er sich vermutlich durch Verstrahlung bei den Atombombenversuchen zugezogen hatte.

Szenenbild “The War Room” aus dem Film “Dr. Strangelove…” von Stanley Kubrick , 1964. In der brillianten Farce “Dr. Strangelove or : How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb” von Stanley Kubrick aus dem Jahre 1964 wird JvN ein schwarz humoriges, satirisches Denkmal gesetzt. Dr. Seltsam (ebd. “Strangelove“) ist Wissenschaftler und Präsidentenberater, ein (deutscher) Emigrant, der mit der Erlangung der amerikanischenStaatsbürgerschaft seinen eigentlichen Namen übersetzte [2].
In einer späteren Szene im Bomber, als die Atombombe versehentlich ins Feindesland geflogen wird, erklingt das Lied “When Johnny comes marching home”. Dies ist kein Zufall, sondern von dem detailbesessenen Kubrick wohl kalkuliert. Bekanntlich wurde JvN von seinen Feunden “Johnny” genannt. Dr. Strangelove sitzt im Rollstuhl wie auch JvN nach seiner Erkrankung 1956.
Quelle : (c) Columbia Pictures, 1964
Die jungen Jahre in Europa
”No matter what disaster overtook him, the man with extraordinary talents, competence, mother wit, and charm would always survive – if not in Hungary, then somewhere else.“[3] Eine wissenschaftliche Laufbahn, wenn möglich ausser halb Ungarns, war neben einer klassischen Karriere im Bank oder Handelsbereich eine Möglichkeit, seine “außergewöhnlichen Talente“ zur Schaffung eines gewissen Status einzusetzen. Für JvNs Familie, jüdischer Herkunft, war klar, dass in der Wissenschaftsgemeinde der Antisemitismus eine völlig untergeordnete Rolle spielen würde als in anderen Gesellschaftsbereichen. Edward Teller , wie von Neumann Jude der Budapester Mittelklasse, sah einen Zusammenhang zwischen Überleben und wissenschaftlichem Erfolg [3]: ”Edward Teller has said that had he known as a youth ‘that Hungary was foundering’ and if he wanted to survive he would ‘have to be better, much better than anyone else.’“ Vermutlich waren es auch diese besonderen Umstände, die eine erfolgreiche Elite von jüdischen Wissenschaftlern ungarischer Herkunft hervorbrachten. ”When asked about his [JvN’s] own opinion on what contri buted to this statistically unlikely phenomenon, he would say that it was a coincidence of some cultural factors which he could not make precise : an external pressure on the whole society of this part of Central Europe, a subconscious feeling of extreme insecurity in individuals, and the necessity of producing the unusual or facing extinction.“ [3]. Das Zitat belegt, daß sich JvN bewußt war, in seiner persönlichen Entwicklung von gesellschaftlichen Faktoren beeinflußt worden zu sein.
Die Anfänge in den USA
Nach Tätigkeiten in Göttingen als Stipendiat der RockefellerStiftung (bei Prof. Hilbert) und als jüngster Privatdozent an der Universität Berlin (19271930), sowie an der Universität Hamburg (19291930), folgte JvN 1930 einer Ein ladung für eine einjährige Gastdozentur nach Princeton, USA, wo er ab 1931 festes Fakultätsmitglied, und schließlich 1933 zusammen mit Albert Einstein, Hermann Weyl und weiteren bedeutenden Mathematikern und Physikern in das neugeschaffene Institute for Advanced Study (IAS) in Princeton berufen wurde. Mit seiner Ernennung zum festen Fakultätsmitglied in Princeton im Jahr 1931 verlegte JvN seine Wohnsitz im selben Jahr noch in die USA und nahm die amerikanische Staatsbürgerschaft an.
JvN wurde am 28 Dezember, 1903, in Budapest, Ungarn, als Janocz/János
Neumann geboren, und starb in Wahington D.C. am 8 Februar, 1957. [4]1 Er war das Älteste von 6 Kindern und fiel schon früh durch sein aussergewöhnliches, photographisches Gedächtnis auf. Er promovierte in Mathematik an der Universität von Budapest im Alter von 23 Jahren mit Bestnote. An der ETH Zürich, Schweiz, machte er 1925 ausserdem den Abschluss im Fach Chemie. 1927 trat er eine Privatdozentur an der Universität von Berlin an, und wechselte 1929 wiederum als Privatdozent an die Universität Hamburg. Im Jahr 1930 kam er in die vereinigten Staaten von Amerika und arbeitete als “visiting professor” in Princeton, wo er ein Jahr später eine volle Professur erhielt. [58]

Der Patriot und das ManhattanProjekt
JvN „fragte sich, wie er seine Kräfte (in dem von ihm vorhergesehenen Krieg; Anm. d.Verf.) am besten für Amerika einsetzen könnte“ [9] und entschloß sich 1937 zu einer Bewerbung als Reserveleutnant in der Artillerie der US Armee. Um die notwendigen Prüfungen zu absolvieren, prägte er sich die entsprechenden Armeehandbücher ein, und schloss das Examen mit Bestnoten ab. Leider wurde er aufgrund seines nicht mehr ganz jungen Alters von 35 Jahren abgelehnt. Selbst ein Protestbrief von Senator William H. Smathers an den Secretary of War, Harry H. Woodring, konnte an dieser Tatsache nichts ändern. Der Umstand, dass sich JvN seit 1940 (vgl. Appendix A, 1940) mit mathematischer Hydrodynamik, d.h. mit den in diesem Zusammenhang auftretenden partiellen Differentialgleichungen beschäftigte, und ausserdem Berechnungen zur Wirksamkeit von Explosionen anstellte, führte zu weiteren Kontakten mit dem amerikanischen Militär. Der “Verbindungsmann” zur Armee war sein Fachkollege in Princeton, Oswald Veblen, der als Offizier im Ersten Weltkrieg enge Kontakte zur militärischen Forschung aufgebaut hatte. Dieser schlug JvN als Berater für die Versuchsanlage der Armee in Aberdeen Proving Ground in Maryland vor. JvN wurde im September 1940 im dortigen Ballistic Research Laboratory Mitglied des wissenschaftlichen Beraterstabes.
Besonders die US-Immigranten unter den Wissenschaftlern fürchteten die vermeintlichen deutschen Fortschritte in der Entwicklung der Atombombe. Edward Teller schreibt in seinen Memoiren [10]: “Bohr had told us that Heisen berg was working on the German atomic bomb… The thought of how far the Germans might have come in the years since the discovery of fission was enough to give us all nightmares.“ Der aus Ungarn emigrierte Physiker L. Szilard formulierte gemeinsam mit Eugene Wigner und Edward Teller am 2. August 1939 einen Brief an den amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt. Sie verleihen darin ihrer festen Überzeugung Ausdruck, dass die Entwicklung der amerikanischen Atombombe vorangetrieben werden solle. Nur so könne ein deutscher Vorsprung verhindert werden. Szilard überzeugte 1939 sogar A. Einstein, diesen Aufruf mitzuunterzeichnen. Dies war der Auslöser für das sogenannte “Manhattan-Project” zur Entwicklung der Atombombe, welches Präsident Roosevelt nach einigem Zögern am 17. Juni 1942 autorisierte. Am Ende war es tatsächlich die Furcht vor der deutschen Bombe, die das nukleare Großlabor in Los Alamos Realität werden liess.
Das Target Committee und der Abwurf der Atombomben
Da die Nuklearforschung in erster Linie in den Händen von Physikern lag, war JvN nicht von Anfang an involviert. Er kam auf Einladung von R. Oppenheimer im September 1943 als beratender Mathematiker zum Manhattan Projekt. Aufgrund seiner Erfahrungen mit Schockwellengleichungen reiste er von da an regelmäßig nach Los Alamos, um schwierige mathematischen Probleme zu lösen.
Der Abwurf der Bomben war für JvN allem Anschein nach nicht mit moralischen Konflikten verknüpft, sondern einfach das nüchterne Resultat politischer und strategischer Erwägungen. Er war im sogenannten Target Committee aktiv daran beteiligt, die in Frage kommenden japanischen Ziele auszuwählen. Obwohl er sich der ungeheuren Zerstörungskraft der Bombe bewusst war, befürwortete er deren Abwurf über dicht besiedelten Gebieten. JvN unter stützte die Entscheidung für Kyoto, eine für religiöse Japaner heilige Stadt. Er war durch ein Memorandum der Air Force von der Eignung Kyotos als Abwurfsort überzeugt worden. (Der JvN Biograph Norman Macrae wirft den Verfassern dieses Schreibens verharmlosend einen “Mangel an psychologischem Fingerspitzengefühl“ vor [11]).
Der kalte Krieg und die “ Superbombe“
Nach dem Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki wurde das zuvor geheime ManhattanProjekt und die darin entwickelten nuklearen Waffen in den USA zum kontrovers diskutierten Thema. Der Krieg war vorüber, und es stellte sich die die Frage, wie und ob die Atomwaffenproduktion in Friedenszeiten fortgeführt werden sollte. Selbst der wissenschaftliche Leiter von Los Alamos, R. Oppenheimer, begann bald nach Kriegsende daran zu zweifeln, ob der eingeschlagene Weg der richtige gewesen war. Er fühlte sich schuldig. 1946 sagte Oppenheimer zu Präsident Truman die berühmt gewordenen Worte [12] : ”Mr. President, I have blood on my hands.“ Er bedauerte seine Teil nahme am Bau der Bombe mit einem Zitat aus dem Hindubibel, der Bhagawadgita [11]: „Nun bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welt.“ Die Vermutung liegt nahe, daß JvN derartige moralische Bedenken fremd waren. Seine zynische Reaktion zitiert Ulam [13]: ”Johnny used to say, ‘Some people profess guilt to claim credit for the sin’.“ Zusammen mit E. Lawrence, A. Compton und E. Fermi schrieb R. Oppenheimer wenige Tage nach dem Abwurf einen Brief an den Secretary of War , Henry Stimson, in dem die Wissenschaftler die Gefahr einer Weiter entwicklung der atomaren Waffen betonten. Um dem Brief Nachdruck zu verleihen, brachte ihn Oppenheimer selbst nach Washington [14] : “We have grave doubts that this further development can contribute essentially or perma nently to the prevention of war. We believe that the safety of this nation … cannot lie wholly or even primarily in its scientific or technical prowess. It can be based only on making future wars impossible.“
Die politische Karriere
Seit Ende des Kriegs widmete JvN seine Arbeit zunehmend der amerikanischen Verteidigungspolitik. Seine mathe matischen Arbeiten und Forschungen am IAS in Princeton standen hinter seinen finanziell einträglichen Tätigkeiten für die Regierung und die Industrie zurück. Neben seiner Beratertätigkeit in Los Alamos von 1943 bis 1955 war er bereits seit 1940 Mitglied des Scientific Advisory Boards in der ballistischen Versuchsanlage in Aberdeen Proving Ground in Maryland. Dies war seine erste wichtige Regierungsanstellung. Viele weitere Positionen kamen in den nächsten Jahren hinzu. So arbeitete er im Bureau of Ordnance der Navy, sowie der Army und als Mitglied im National Defense Research Committee. Er beriet zudem die CIA, Unternehmen wie IBM, RAND Corporation und Standard Oil. Von 1950 bis 1955 war JvN Mitglied des Armed Forces Special Weapons Project in Washington. Seit 1952 war er zusätzlich als Mitglied im General Advisory Board, dem Hauptberatungsausschuß des AEC, vereidigt. Er saß ab 1953 dann dem Air Force Strategic Missiles Evaluation Committee vor. JvN half außerdem bei der Entwicklung von SAGE (SemiAutomatic Ground Environment), einem Computersystem, das die Aufgabe hatte, einen sowjetischen nuklearen Angriff frühzeitig zu erkennen.
Ein persönlicher Blick auf JvN von Stephen Wolfram
Der folgende Abschnitt zitiert einen Forumsbeitrag zum 100sten Geburtstag von JvN aus der Feder von Stephen Wolfr am, dem berühmten Entwickler von “Mathematica”, “Publicon” usw. (siehe http://www.wolframscience.com) [15]. Der Verfasser dieser Arbeit hat diesen Beitrag zufällig gefunden, als er nach Videodokumenten von und über JvN suchte. Die Antwort ist [15] : “One video clip of him has survived. In 1955 he was on a television show called “Youth Wants to Know”, which today seems painfully hokey. Surrounded by teenage kids, he is introduced as a commissioner of the Atomic Energy Commission which in those days was a big deal.” S. Wolfram kennt nicht nur viele der Kollegen JvNs, sondern ist im Grunde auch Erbe seiner Ideen. Denken wir z.B. an den Begriff des heuris tischen Computings (3.1) und daran, wie viele von uns wie selbstverständlich mit Programmen wie Mathematica ein Gefühl für komplexe mathematische Zusammenhänge gewinnen, indem sie damit Analysen durchführen. Am Ende des Aufsatzes erfahren wir Überraschendes für das Jahr 2007 [15] : “She [JvNs Tochter Marina] told me that when he died, he left a box that he directed should be opened fifty years after his death. What does it contain? His last sober predictions of a future we have now seen? Or a joke like a funny party hat of the type he liked to wear? It’ll be most interesting in 2007 to find out.”
JvN und die Mathematik
Wie der mengentheoretische Elephant in die ToG kam
Die ToG ist definitiv ein wissenschaftlicher Meilenstein im Leben ihrer Autoren JvN und OM. Obwohl sie beide in den Jahren 1935 bis 1937 in Karl Mengers ”Wiener Kolloquium“ Vorträge hielten, haben sie sich dort niemals getroffen. Selbst als OM im Januar 1938 während einer Vortragsreise in den USA die Möglichkeit hatte das IAS in Princeton zu besuchen, kam es abermals nicht dazu, dass beide sich kennenlernten. Erst nach seiner Emigration im Jahr 1938 als OM in Princeton einen Lehrauftrag als “Class of 1913“ Professur in politische Ökonomie innehatte, nahm am 1. Februar des Jahres 1939 ihre viele Jahre andauernde, fruchtbare Zusammenarbeit und Freundschaft ihren Anfang. Auch wenn JvN seit 1942 in Washington für die US Navy arbeitete, konnten beide ihre Mammutwerk Ende 1942 vollenden, und nach einer längeren Drucklegungsphase am 18.9.1944 schließlich der Öffentlichkeit vorstellen.

OM promovierte 1925 an der berühmten Wiener Schule der Ökonomie. Sein Forschungs interesse galt der Spekulation und der ökonomischen Prädiktion. Unterstützt von der Rock efeller Stiftung habilitierte er 1928 über das Thema Wirtschaftsprognose [16] OM war aktiv in Karl Mengers “Wiener Kolloquium” und holte auf dessen Empfehlung den bekannten Statistiker Abraham Wald in das österreichische Institut für Konjunkturforschung holte, wo er Direktor und Professor von 1935 bis 1938 war [17]. 1938 emigrierte er in die Vereinigten Staaten, wo er Professor an der Princeton Univer sity und Direktor des “Economic Research Program” war. Im Jahr 1963 gründete OM zusammen mit Paul F. Lazar sfeld das Institut für Höhere Studien (IHS) in Wien, das er bis 1970 auch leitete [18]. Die Einschätzungen der Leistungen von OM sind bisweilen unangemessen [19] : so gilt der frühe OM nach P.Mirowski [20] als ”more or less … a typical Austrian economist of the fourth generation” , und Leonard [21] meint, dass OM “remained personally incapable of taking the theoretical steps that he himself envisioned . . . ” . Ein Verdienst von OM ist es als treibende Kraft JvN zum Schreiben an der ToG bewegt zu haben. OM hat viele Modelle zur Spielanalyse zur ToG beigesteuert : die Beiträge von Cournot zum 2Personenspiel, Arbeiten von Böhm-Bawerk und dem Mathematiker Birkhoff [19]. OM ist nicht nur Koautor der ToG, sondern auch von C. Granger [22], J ohn Kemeny and G. L. Thompson [23] und [24].
Die ToG in ihrer Wirkung
Die ToG war ein Bruch mit herkömmlichen ökonomischen Methoden. Sie war formal nicht nur eine streng mathe matische Analyse strategischer Spiele und lieferte eine Axiomatisierung der maßtheoretischen Nutzentheorie, sondern bezog direkt “artfremde“ Disziplinen wie Soziologie und Politik mit ein. Die in der Zeit zwischen den Weltkriegen veröffentlichten Arbeiten zu strategischen Spielen [25], [26], [2728] waren nur einem kleinen Kreis europäischer Mathematiker bekannt. In dieser Phase fand auch der Übergang der Betrachtung des reinen Glücksspiels zum strategischen Spiel statt [19]. Mit der ToG war eine Basis geschaffen worden für die spieltheoretische Forschung. Standen zu Beginn des kalten Kriegs noch Fragen der militärischen Taktik im Vordergrund, so rückte in der Folgezeit die Makroökonomie und der internationale Handel als Strategieproblem in den Mittelpunkt. Bis kurz nach dem Erscheinen des Buches waren nicht nur W. Pauli und H. Weyl, sondern sogar JvN selbst der Meinung, dass bis zur breiten Akzeptanz der ToG viele Jahre vergehen würden [29]. Doch es kam anders.
JvN und die Automatentheorie
Heuristisches Computing und und JvNs JONIAC
JvN war bis zum Krieg in erster Linie der Mathematik verbunden. Während des Krieges kam er immer mehr in Berührung mit Computern und Computingproblemen. Und genau das war nach dem Krieg sein Hauptinteresse. Auslöser waren seine Studien zur Flüssigkeitsdynamik. Die auftretenden Phänomene werden mathematisch durch nichtlineare partiell differenzierbare Gleichungen beschrieben. Sein spezielles Interesse an dynamischer Turbulenz und der Interaktion von Schockwellen führte in bald an einen Punkt wo ihm bewusst wurde, dass die existierenden analytischen Methoden nicht mehr ausreichend waren [30]. JvN fand die Antwort im Elektronenrechner. Während des Krieges fand er immer neue Einsatzgebiete für den Rechner wie zum Beispiel die Nukleartechnologie. In diesem Zusammenhang entwickelte er eine allgemeine Methode für den Gebrauch von Computern. Sie bestand darin, im Fall ungelöster Probleme eine Vielzahl von Spezialfällen vom Computer berechnen zu lassen, um daraus Strukturen für eine Verallgemeinerung der Resultate ableiten und um theoretische Grundlagen weiterentwickeln zu können. Also sind die Lösungen des Computers nicht das eigentliche Ziel sondern eine Hilfestellungen neue Konzepte zu entdecken. Dies nennt man den heuristischen Einsatz des Computers [31].
Die Theorie der selbstreproduzierenden Automaten
In den späten 40ger Jahren begann JvN an der Automatentheorie zu arbeiten. Sein Ziel war es, eine systematische Theorie aufzubauen, die das Verständnis natürlicher Automaten (z.B. das Nervensystem) befördern sollte und gleich zeitig der Entwicklung analoger bzw. digitaler künstliche Automaten (Computer) dienlich wäre. Zu diesem Zweck verfasste JvN fünf Arbeiten :
1, “The General and Logical Theory of Automata“ (siehe Appendix A, 1951)
2, “Theory and Organisation of Complicated Automata“(5 Vorlesungen an der University of Illinois Dez., 1949) 3, “Probabilistic Logics and the Synthesis of Reliable Organisms from Unreliable Components”
(siehe Appendix A, 1956)
4, “The Theory of Automata : Construction, Reproduction, Homogeneity” (Manuskript, geschrieben Herbst 1952 Ende 1953)
5, “The Computer and the Brain” [32] (siehe Abschnitte 3.3, 3.4 und Appendix A, 1958)
Nr.2, und Nr.4, lagen bis nach JvNs Tod als völlig uneditierte Manuskripte vor. A.Burks hat 1966 diese beiden Manuskripte editiert und als Buch herausgebracht [30]. Damit konnte er JvNs Arbeiten über die Automaten quasi “zum Abschluss” bringen. JvNs Absicht war es, das Thema komplett zu erschließen. Das heisst, er wollte nicht nur das Nervensystem in seiner Wirkungsweise und Funktionalität durchleuchten, sondern damit im Prinzip die künftigen Großrechner in ihrer Architektur entwerfen. Er verfolgte die Frage nach der logischen Organisation komplexer Systeme von CEs (Computing Elements). Komplexität bedeutet in diesem Zusammenhang erstens Zuverlässigkeit (”Reliability“) von solchen Anordnungen, und zweitens die Selbstreproduzierbarkeit eines Automaten. Die Frage der Zuverlässigkeit wurde von JvN in aller Länge in der Arbeit 3, diskutiert. Die dem Buch [30] zu Grunde liegenden Manuskripte 2, und 4, waren unvollendet aufgrund seines frühen Todes. Er hatte der Universität von Illinois seine Einwilligung gegeben, ein Buch über Automatentheorie zu schreiben, das aus den fünf dort im Dezember 1949 zu eben diesem Thema gehaltenen Vorlesungen hervorgehen sollte.
Die tragische Geschichte um “ The Computer and the Brain”
Zum ersten Mal seit 1933 hatte JvN 1955 dem IAS und Princeton den Rücken gekehrt, da ihn seine Aufgabe in der Atomenergiebehörde AEC in Washington vollständig forderte. Nur sein brennendes Interesse an der Automaten theorie und sein unermüdlicher Fleiß ließen ihn in nächtlichen Stunden ein Manuskript für die Silliman Lectures1 erstellen, die ihn die Yale University Anfang 1955 zu halten eingeladen hatte [32]. Monate später im August änderte sich ihr Leben radikal. Die Ärzte diagnostizierten Knochenkrebs in JvNs rechter Schulter. Im Verlauf dieser Krankheit gelang es JvN nicht mehr das Manuskript zu vollenden. Er starb am 8.2.1957. Das vorhandene Manuskript
brachte die Yale University Press Anfang 1958 ein paar Monate nach seinem Tod mit Titel “The Computer and the Brain” heraus. Dieses Buch liegt auch heute noch nach P. & P. Churchland in [33] “at the eye of a hurricane”.
“ The Computer and the Brain” im Abriss
Dieser Abschnitt ist ein Versuch, die Hauptthesen von CatB [33] wiederzugeben. CatB ist nach JvN sinngemäß der Versuch einer systematischen Annäherung an das Problem die Funktionsweise des Nervensystems zu verstehen aus Sicht des Mathematikers bzw. des Computeringenieurs. Hierbei werden Methoden aufgezeigt und hinsichtlich ihres wahrscheinlichen Erfolgs oder Misserfolgs betrachtet. Logische und statistische Argumente stehen dabei im Vorder grund. Bei seinem Versuch Gehirn (Neuronenstruktur) und Elektronenrechner zu vergleichen, spricht er von “natürlichen” und “künstlichen Automaten“
JvN und die Physik
JvNs Beitrag zur Quantentheorie
Der Verfasser möchte an dieser Stelle ganz besonders Prof. Loo von der UCLA danken, der uns mit seinem grossen Wissen um die Quantentheorie und die diesbezüglichen Leistungen JvNs in einem Interview zur Verfügung gestanden hat. Dieses fand telefonisch am 20.April 2006 statt. Wir haben im folgenden die Aussagen von Prof. Loo so ergänzt, dass ein durchgängiger Text entstanden ist.
JvNs Hauptbeiträge zur Quantentheorie sind erstens die Formulierung einer rigorosen, auf Axiomen basierenden, mathematischen Grundlegung der Quantenmechanik und zweitens die mathematische Beschreibungen ihrer statistischen Natur, ohne sich dabei in metaphysikalisches Geplänkel zu verlieren.
Biographischer Hintergrund
Hintergründe und die jungen Jahre in Europa
Die Erziehung JvNs war ganz darauf ausgerichtet, ihm eine wissenschaftliche Karriere zu ermöglichen. Seine Gymnasialzeit verbrachte er auf dem humanistischen LutheranerGymnasium, “a high school with a strong academic reputation“ [34]. Seine Lehrer erkannten schnell seine außergewöhnliche Begabung und beschlossen, ihn bevorzugt zu fördern. Sie ermöglichten ihm die Zusammenarbeit mit Mathematikern von der Universität Budapest. Aufgrund dieser Förderung veröffentlichte JvN gemeinsam mit dem Mathematiker M. Fekete schon während seiner Schulzeit seine erste wissenschaftliche Arbeit (Appendix A, 1922).
Auch historische und politische Fakten eignete sich JvN früh an. Bereits ab seiner Jugendzeit verfügte er über umfang reiches Geschichtswissen, welches er auf aktuelle Tagespolitik übertragen konnte. W. Poundstone schreibt [34] : “By the outbreak of World War I, Johnny … could draw analogies between current events and historical ones, and discuss
both in relation to theories of military and political strategy.“ Eine prägende Erfahrung in der Jugend JvNs war ein fünf Monate währendes kommunistisches Regime in Ungarn 1919. Seine Abneigung gegenüber dem Kommunismus wird von einigen Autoren auf die Erfahrungen während dieser Zeit zurückgeführt [3]. Poundstone unterstreicht in seinem Buch die Bedeutung dieser Monate für von Neumanns spätere politische Ansichten [34] : “The Neumanns’ experience of the Kun regime deserves mention, as it may bear on von Neumann’s political conservatism and distrust of the Soviet Union.“ Im März 1919 kam es unter Führung des Anwalts und Journalisten B. Kun zu einer Revolution, die dazu führte, daß die kommunistische Partei für kurze Zeit die Macht an sich reissen und eine Diktatur errichten konnte. Bereits im August 1919 marschierten konterrevolutionäre Truppen unter General Horthy in Budapest ein, welche die Revolution blutig niederschlugen. Während der kommunistischen Herrschaft kamen etwa 500 Menschen ums Leben. Nach dem Ende der kommunistischen Diktatur setzte die HorthyRegierung zum Gegenschlag an. Insgesamt 5.000 Menschen wurden ermordet und über 100.000 mußten aus Ungarn fliehen. Besonders in ländlichen Gebieten kam es zu Lynchjustiz gegenüber Menschen, ”whose offence was simply that of belonging to the same race of Kun.“ [3]
Dieser kurze Blick auf die Geschichte Ungarns veranschaulicht sehr eindrücklich das Dilemma, in dem sich die ungarischen Juden befanden. B. Kun war ein assimilierter Jude, der als Kriegsgefangener in Rußland zu einem Gefolgsmann Lenins wurde. Er ist ein Beispiel für die Juden, die versuchten, die Gesellschaft radikal zu verändern, um so eine gesichertere Stellung zu erreichen. Erst nach Ende der Revolution wurde deutlich, welche fatalen Folgen die kurze Zeit des Kommunismus für die Juden in Ungarn haben würde. Während der Revolution hatten vor allem Juden die Positionen des vertriebenen Adels in der Regierung eingenommen. Ebenso war ein Großteil der Polit offiziere des KunRegimes jüdischer Abstammung. Die HorthyRegierung nahm dies zum Anlaß, antisemitische Maßnahmen zu ergreifen – die ersten seit über 50 Jahren. So wurde zum Beispiel der Zugang zur Universität derart reglementiert, daß er “so exakt wie möglich den relativen Bevölkerungsanteil der verschiedenen Rassen und Nationalitäten” widerspiegeln sollte [11]. Dieses Gesetz sah vor, daß nur noch fünf Prozent der Studenten Juden sein sollten. Trotz solcher und anderer antisemitischer Regelungen arbeitete die Regierung weiterhin mit führenden jüdischen Bankiers und Industriellen zusammen, da sie deren Unterstützung benötigte. Da die Sicherheit der von Neumanns durch die Revolution gefährdet war, verließen sie Ungarn. Dies gelang ihnen ohne Schwierigkeiten, denn ”die Familie war reich genug, um umgehend mit dem Nachtzug an die Adria aus zuweichen.“ [11] Die folgenden Monate verbrachten die von Neumanns entweder in Abbazia an der Adria oder in Wien. Durch die finanziellen Möglichkeiten der Familie war diese Flucht nicht sehr unkomfortabel, dennoch “kann das Bewußtsein aus dem eigenen Haus vertrieben zu werden, niemals angenehm sein.“ [3]Für JvN waren also die ersten Erfahrungen mit dem Kommunismus die einer Gewaltherrschaft. Mit der Revolution in Ungarn wurde eine der größten Ängste der angepaßten Juden zur Realität : durch gesellschaftliche Umwälzungen liefen sie in Gefahr, ihren Besitz und ihre gesellschaftliche Position zu verlieren. Betrachtet man die Familiengeschichte JvNs als Teil der Historie der Juden, kann deshalb die kurze Zeit der KunDiktatur in Ungarn als eine der Ursachen für seine Ab neigung gegen den Kommunismus und die Sowjetunion verstanden werden.
N. Macrae schreibt, daß JvN den Kommunismus auch deshalb ablehnte, weil dieser wirtschaftlich nicht funktioniert habe, und führt so einen weiteren Grund an, warum die Ungarn eine ”gründliche Abscheu“ [11] vor Rußland empfanden. Viele ungarische Juden, die sich nach der Revolution vor der Rache Horthys fürchteten, flohen nach Rußland. Da dort aber Verbindungen mit dem Ausland nicht gern gesehen waren und man durch deren Aufrecht erhaltung sein Leben riskierte, gab es bald keinen Kontakt mehr zu diesen Flüchtlingen. Bei den in Ungarn ver bliebenen Angehörigen verfestigte sich dadurch eine negative Haltung gegenüber Rußland und den Kommunisten. JvN lernte Rußland einige Jahre darauf kennen. Er besuchte während seiner letzten Vortragsreihe durch Europa im September 1935 Moskau, eine Stadt, die vom Stalinismus gezeichnet war. Durch seine Kontakte mit eingeschüchterten russischen Gelehrten sah er sich in seinen Befürchtungen bezüglich des Kommunismus bestätigt. Geprägt von seinen Erlebnissen als Kind im März 1919 und trotz der in Deutschland immer stärker werdenden antisemitischen und faschistischen Tendenzen, fürchtete JvN in dieser Zeit den Kommunismus mehr als den Faschis mus. Hier liegt vermutlich die Ursache, weshalb JvN die Sowjetunion lebenslang als gefährlichen Feind ansah

Das Lutheraner Gymnasium in Budapest (Aufn. privat, 2000)
JvN kam 1914 in das Lutheraner Gymnasium. Die Leistungen der Budapester Gymnasien war zu der Zeit auf einem Höhepunkt [1]. Seine Mathematiklehrer waren bekannte Männer wie L. Rátz und J . Wigner , die sein ausserordentliches Talent schnell erkannten. Rátz war es auch, der JvNs Vater Max von Neumann besuchte und ihn davon überzeugen konnte, dass sein Sohn über das übliche schulische Angebot hinaus gleich an der Universiät eine mathe matische Ausbildung bekommen sollte. Dies sollte ausserdem mit keinerlei Kosten verbunden sein. Max von Neuman war sofort einverstanden. Rátz vertraute seine Schützling Professor Kür schák an, der wiederum Gábor (Gabr iel) Szegó als Tutor für JvN gewinnen konnte. (Szegó wurde nach 1938 Dekan des mathematischen Instituts an der Stanford University [35]. Bald wurde JvN an der Budapester Universität wie ein Kollege behandelt. Mit 17 veröffent lichte er seine erste wissenschaftliche Arbeit (Appendix A, 1922).
JvN wechselte 1923 an die Eidgenössische Technischen Hochschule (ETH) nach Zürich. Zeitgleich war er Student der Mathematik an der Universität in Budapest. 1925 veröffentlichte er seine Doktorarbeit mit dem Titel “Eine Axioma tisierung der Mengenlehre“. Im Jahr darauf erhielt er mit 22 Jahren in Budapest seinen Doktortitel in Mathematik. Nach Abschluß seines Studiums erhielt JvN ein Stipendium der Rockefeller Stiftung. Dies war der erste Kontakt mit den Amerikanern. Bereits wenige Jahre darauf lernte er Amerika persönlich kennen. Seinem Interesse an der Mathematik folgend, ging JvN nach seinem Studium nach Göttingen zu David Hilbert, einem der berühmtesten Mathematiker in Europa. In den folgenden Jahren arbeitete er zudem als Privatdozent in Berlin und in Hamburg. In dieser Zeit begann sich die politische Situation in Deutschland zunehmend zu verschlechtern. Ab 1933 wurden einige hundert jüdische Akademiker infolge des antisemitischen “Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ von den deutschen Universitäten verwiesen. Besonders in den Fachbereichen der Physik, der Mathematik und der Medizin, in denen bis zu dieser Zeit viele jüdische Wissenschaftler gelehrt hatten, trugen die Gesetze der National sozialisten zu einer Beschleunigung der bereits begonnenen Emigrationsbewegung bei. Unter den Flüchtenden befanden sich unter anderem viele derjenigen Physiker und Mathematiker, die später den Bau der Atombombe in den USA ermöglichen sollten. Durch die kontinuierliche Emigration von Akademikern verlor Deutschland in den folgenden Jahren an wissenschaftlicher Bedeutung. JvN und sein ungarischer Schulfreund, der Physiker E. Wigner , mit dem er gemeinsam fünf wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht hatte, erhielten 1930 das Angebot, an der Universität Princeton in New Jersey zu lehren. Bevor er seinen Lebensmittelpunkt in die Vereinigten Staaten verlegte, verbrachte er den Winter in Princeton und reiste im Sommer nach Europa. Mit der Machtergreifung Hitlers 1933 gab er seine Stellung in Berlin auf und zog nach New Jersey. In einem Brief an Professor Oswald Veblen, Mathematiker in Princeton, machte JvN im Juni desselben Jahres deutlich, was er für die Entwicklung an deutschen Universitäten durch den Einfluß der Nationalsozialisten voraussah [3]: ” … if these boys continue for only two more years (which is unfortunately very probable), they will ruin German science for a generation at least.“
Die Anfänge in den USA
Vor Beginn des Krieges hatte sich JvN durch seine Arbeiten zur Neuordnung der Gruppentheorie, die Bertrand Russell mit seinen logischen Paradoxa in Frage gestellt hatte, einen Namen in der Mathematik gemacht. Er veröffentlichte in dieser Zeit ebenso Arbeiten zur Mathematisierung der Quantenmechanik, sowie eine frühe Arbeit zur Spieltheorie. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, hatte er sich bereits als herausragender Mathematiker in Europa und Amerika etabliert. Wenige Monate nach Antritt seiner neuen Stelle am Institute for Advanced Study (IAS) in Princeton am 1. April 1933 stellte JvN bereits den Antrag zur Einbürgerung in die USA und entband sich von seinen Lehrverpflichtungen an der Universität Berlin. Politisch interessiert und informiert, ahnte er bereits früh, daß es zum Krieg in Europa kommen würde [13]: “Von Neumann expressed great pessimism about the possibility of a war in Europe. (This was about three years before the actual outbreak.) Apparently he had a rather clear picture of the catastrophes to come It was really very prophetic.“
Der Patriot und das Manhattan-Project
Seit dem Beginn des Krieges diskutierten amerikanische wie auch immigrierte Wissenschaftler, ob Physiker in Deutschland an der Entwicklung der Atombombe arbeiten würden. Der Disput zwischen Werner Heisenberg und Niels Bohr in Kopenhagen vom September 1941 wird in diesem Zusammenhang oft zitiert. Der deutsche Physiker Heisenberg arbeitete federführend am streng geheimen Uranprojekt der Nationalsozialisten. Nach seiner Darstellung ging es in der Auseinandersetzung zwischen ihm und Bohr darum, ob eine internationale Kooperation in der Atom forschung möglich sei. Bohr sah in Hitlerdeutschland eine Feindesnation und schloss jede Kooperation kategorisch aus. Die Physiker diskutierten die grundsätzliche Frage, ob ein Wissenschaftler seine Fähigkeiten in den Dienst des Krieges stellen sollte. Heisenberg schreibt wie folgt [36]: ”Bohr war über meine Antwort entsetzt und nahm offen sichtlich an, ich wolle ihm zu verstehen geben, daß Deutschland auf dem Wege zur Herstellung von Atomwaffen große Fortschritte gemacht habe.“ Bohr emigrierte bald daruf aus Dänemark in die USA und begann die amerikanischen Physiker bei ihren Atombombenplänen zu beraten. Er berichtete 1943 [37] : ”Die Deutschen wissen, daß man Atom bomben machen kann.“

Luftaufnahme des Los Alamos National Laboratory, 1946
Das Los Alamos National Laboratory (LANL) erstreckt sich auf über 28,000 Hektar am Rande der Stadt of Los Alamos, New Mexico, die ungefähr 25 Meilen nordwestlich von Santa Fe liegt. Es wurde 1943 als Versuchlabor für Nuklearwaffen gegründet unter der Leitung des 38jährigen J . Robert Oppenheimer (der diese Stellung seit dem 15. März 1943 inne hatte). Getrieben von der Furcht Hitlerdeutschland könnte die Atombombe vor ihnen besitzen, ließen ameri kanische Militärs den Komplex in nur wenigen Wochen errichten. Ihre Erbauer wurden nicht davon unterrichtet, für welchen Zweck Laboratorien, Produktionsstätten, Wacht türme, aber auch Spitäler, Wohnhäuser und Frisiersalons entstanden. R. Oppenheimer hatte Ende 1942 das Terrain in der Wüste für den Bau der Anlagen vorgeschlagen. Geo graphisch günstig gelegen, verfügt das Gelände nur über eine einzige Zufahrtsstraße. Fernab der Zivilisation ist es der ideale Ort für das “Manhattan Engineer District“, so der Deckname während des Krieges. Dem Projekt wurden bereits ab September 1942 von der USAdministration die höchsten Sicherheits und Prioritätsstufen eingeräumt. Bis 1954 blieb Los Alamos ein in sich geschlossenes Gemeinwesen, das nur mit Sondergenehmigung zu betreten war.
Das Ziel des Manhatten Projects war der Bau der Atombombe, und dabei wollte man den Deutschen zuvor kommen. Die Öffentlichkeit wie auch die lokale Bevölkerung wurden über den Zweck der errichteten Anlage im Unklaren gelassen.
Quelle : http://www.lasg.org
Zu Beginn des wissenschaftlichen Großprojekts in Los Alamos am 15. April 1943 war offen, ob es möglich sein würde, eine Kettenreaktion zu erzeugen, die die Explosion der Atombombe erst ermöglichen würde. Ebenfalls war die benötigte Menge an Uran 235 und Plutonium nicht vorhanden. Das Team um R. Oppenheimer ermittelte die kritische Masse für die kontrollierte Kettenreaktion erst kurze Zeit vor dem ersten Atombombenversuch. Es gelang
den Wissenschaftlern noch während der letzten Kämpfe des Zweiten Weltkrieges, genügend spaltbares Material für drei einsatzfähige Atombomben herzustellen: zwei PlutoniumBomben und die Uran235Bombe, die Hiroshima zerstören sollte. Am 16. Juli 1945 um 5.30 Uhr explodierte die erste Plutoniumbombe erfolgreich in Alamogordo, New Mexico. Die Welt änderte sich an diesem Tag. Nach nur zwei Jahren und drei Monaten seit Beginn der Arbeiten im Waffenlaboratorium von Los Alamos und gut zwei Monate nach der Kapitulation Deutschlands übertraf die Explosion die kühnsten Erwartungen. General Leslie R. Groves schreibt in seinem umfassenden Bericht an den Secretary of War, Henry Stimson, am 18. Juli über diesen sogenannten “TrinityTest” [38] : “For the first time in history there was a nuclear explosion. And what an explosion!… The test was successful beyond the most optimistic expectations of anyone.“ Zu den Männern, die entscheidend zu diesem Erfolg beigetragen hatten, gehörte JvN. Das amerikanische Kriegsministerium schreibt nach [39] in einem Bericht von 1945 sinngemäß vom “Übertritt der Menschheit in ein neues Zeitalter“. Ganz anders sah es R. Oppenheimer zwei Monate nach dem Abwurf der Atom bomben über Japan, als er davon sprach, dass die Menschheit diese Stadt verfluchen werde. Dennoch wurde das Projekt in der Öffentlichkeit als Erfolg gefeiert.
Die britischen Verbündeten der Amerikaner hatten bereits seit Sommer 1943 darauf hingewiesen, daß Hitler keine Atombombe zu bauen imstande wäre. Der britische Chief Scientific Advisor on Nuclear Matters, Michael Perrin, teilte General Groves diese Auffassung mit. Dieser entgegnete aber [40]: “Well, you may be right, but I don’t believe you.“ Selbst nach der Auswertung der Papiere C. F. von Weizsäckers im Jahr 1944, die ergab, daß Hitlerdeutschland keinesfalls zur Atommacht würde aufsteigen können, konterte Groves [40]: “Unless and until we had positive know ledge to the contrary, we had to assume that the most competent German scientists and engineers were working on an atomic program with full support of their government and with the full capacity of German industry at their disposal.“ Auch ohne die Bedrohung durch deutsche Atomwaffen wollten die Amerikaner an der weiteren Entwicklung der Bombe festhalten. Der Historiker M. J. Sherwin stellt in seinem Buch “A World Destroyed“ fest [40] : “The race for the bomb had already changed from a race against German scientists to a race against the war itself.“ Einige Jahre darauf sollte sich herausstellen, daß General Groves bereits früh die Sowjetunion zu den Feinden der Vereinigten Staaten zählte. Er gab 1954 anläßlich der Sicherheitsanhörung von R. Oppenheimer zu Protokoll [41]: „Seit dem Zeitpunkt, da ich etwa zwei Wochen mit der Leitung dieses Projektes betraut war, habe ich nie irgendwelche Illu sionen darüber gehabt, daß Rußland unser Feind war und daß das Projekt auf dieser Grundlage durchgeführt wurde.“ Diese strategische Sicht teilte vermutlich auch JvN. Einige der beteiligten Wissenschaftler fühlten sich hintergangen. Einstein sagte später im Zusammenhang mit dem von ihm unterzeichneten Brief an Roosevelt [42]: “If I had known that the Germans would not succeed in constructing the atom bomb, I would never have lifted a finger.“
Das Target Komitee und der Abwurf der Atombomben
Die Arbeiten JvNs trugen entscheidend zum Erfolg des ManhattenProjekts bei. Gemeinsam mit Edward Teller empfahl er die Implosionsmethode und beteiligte sich an der Entwicklung der sogenannten Implosionslinse für die NagasakiBombe. Die Berechnungen für diese auf Plutonium basierende Waffe galten als extrem schwierig. JvN war es, der den Einsatz von Computern für die umfangreichen Kalkulationen vorschlug : “[JvN] began persuading us to use computers, pointing out the usefulness that computers would have in our calculations“ so E. Teller in [10]. Im Frühjahr 1944 wurden IBM Maschinen, die mit Lochkarten programmiert wurden, in Los Alamos installiert (erst ab 1950 wurde dort MANIAC, angelehnt an JONIAC gebaut [43]; vgl. dazu 3.1). Diese Rechner wurden für numerische Berechnungen, die die Implosionstechnik erforderte, genutzt. E. Teller konnte anhand von JvNs Modellen die Zerstörungskraft der Atombombe ungefähr abschätzen. So bestimmte er nach dem TrinityTest die Explosionshöhe der Bombe, von der die größtmöglichen Zerstörungen ausgehen würden.
Im sogenannten Target Committee waren neben Vertretern der USRegierung, der Air Force und der Army Security Agency (ASA, später NSA) auch einige Wissenschaftler aus Los Alamos vertreten. Dazu gehörten Leslie Groves und Robert Oppenheimer und der Leiter der mathematischen Abteilung, JvN. Zur Festlegung der in Frage kommenden feindlichen Zielorte kam das Komitee im Mai 1945 mehrfach zusammen. Die Geheimdienste hatten als Ziele große japanische Fabriken vorgeschlagen (und damit “das Ausmaß der Zerstörungskraft [der Bombe] unterschätzt, die man sinnvollerweise gegen ganze Städte statt einzelne Fabriken einsetzen sollte“ [11]). JvN befürwortete die Liste der Air Force. Darauf befanden sich sechs von ursprünglich siebzehn potentiellen Zielen : Kyoto, Hiroshima, Yokohama, der Kaiserpalast in Tokio, die Waffenfabriken von Kokura, sowie die Raffinerien und der Verladehafen von Niigata auf Honshu. Drei Ziele auf dieser Liste wurden aus strategischen Überlegungen verworfen. Einmal der Kaiserpalast in Tokio, weil der Kaiser schliesslich die Kapitulation zu unterzeichnen hatte, und zum anderen Kyoto, weil es als frühere Hauptstadt Japans ein kulturelles und religiöses Zentrum war, in dem auch ein Großteil der intellektuellen Elite wohnte, die wahrscheinlich eine rasche Kapitulation nach dem Abwurf der Bomben befürworten würde, und schliesslich Yokohama, das zu diesem Zeitpunkt schon stark zerbombt war. Man einigte sich schließlich darauf, Hiroshima und die Waffenfabriken in Kokura zu bombardieren. Die Stadt Nagasaki wurde als Ausweichziel bestimmt. Dort begann Japan gerade mit dem Bau eines neuen Hafens, der den von Yokohama ersetzen sollte.
Der Abwurf der “Little Boy“ genannten Bombe mit einer Sprengkraft äquivalent zu 12,5 Kilotonnen TNT über Hiroshima verlief planmäßig. Als wenige Tage später die zweite Bombe “Fat Man“ abgeworfen werden sollte, war die Sicht so schlecht, daß die Piloten beschlossen, das Alternativziel anzufliegen. Doch auch über Nagasaki war der Himmel so stark bewölkt, daß die Bombe durch eine sich anbietende Wolkenlücke abgeworfen wurde. Der geplante Abwurf und Explosionspunkt wurde weit verfehlt. Die Schäden waren somit geringer als das tatsächliche Zerstörungs potential der Bombe mit einer Sprengkraft von 22 Kilotonnen TNT hatten vermuten lassen [11]2 . Am 14. August 1945 ergab sich Japan bedingungslos den Vereinigten Staaten. Die Japaner waren im Sommer des Jahres 1945 militärisch bereits am Ende und ihre Kapitulation nur noch eine Frage der Zeit. Die Sowjetunion hielt zu diesem Zeitpunkt den Neutralitätspakt mit Japan noch aufrecht. Die Amerikaner wollten sicherstellen, daß sich die Japaner den USA ergaben und nicht der UdSSR, da sonst ein wesentlicher Ausgangspunkt für den Einfluß der Amerikaner in Asien verloren wäre. Am 9. August, dem Tag nach dem Abwurf der Atombombe über Hiroshima, erklärte die Sowjetunion Japan den Krieg und begann ihre Truppen in Bewegung zu setzen. Nur einen Tag darauf ergab sich der japanische Kaiser den Amerikanern.
Die Frage nach JvNs Gründen sich so für die Bombe zu engagieren wird von den Biographen verschieden beantwortet. Die Angst vor der deutschen Bombe mag sicher eine Rolle gespielt haben. Macrae [11] führt an, daß die Amerikaner hohe Verluste wie im Ersten Weltkrieg verhindern wollten. Damit folgt er der “orthodoxen Schule“ der USHistoriker. Diese behauptet, der Abwurf wäre erfolgt, um das Ende des Krieges zu forcieren und einen Einmarsch amerikanischer Truppen in Japan obsolet zu machen. Zumal japanische Soldaten als Gegner gelten, die auch in auswegslosen Siuationen bis zum bitteren Ende durchhalten, und so einen hohen Blutzoll fordern. Macrae führt darüberhinaus nichts weiter aus, sondern bemerkt banal : „Er mochte das Dröhnen des Helikopters auf seinem Rasen“ [11]. Steve Heims erklärt dies nachvollziehbarer mit praktischem Karrierismus bzw. dem Wunsch der neuen Heimat besondere Loyalität zu beweisen [3]: „The creation of nuclear weapons offered to a number of HungarianAmerican scientists not only the opportunity but also (at least in the case of von Neumann) the compelling desire to serve and be part of the elite establishment, and to assume a modern American role reminiscent of the court astrologer or court engineer of a feudal military empire“. JvN zeigte darüberhinaus übermäßigen Respekt vor Politikern und offiziellen Stellen. Ulam erinnert sich [13] : “Johnny’s fascination with the military… was due more generally to his admiration for people who had power At any rate, it was clear that he admired people who could influence events“. Heims [3]
führt noch zwei weitere mögliche Gründe an. Einer betrifft eine außer Kontrolle geratene Bürokratie : “It is quite appropriate to view the Manhattan Project as a large bureaucracy to account for itself it needed tangible results.
…the second bomb had to be used too because it worked on a different principle , whose effectiveness had to be justified“. Hierbei zitiert er auch aus ”Roots of War“ von Richard J . Barnets : nach Barnet ist der Abwurf der Bombe eine Handlung “not to stop a bureaucratic process in which more than $2 billion and four years of incredible effort had been invested“. Der zweite Grund, der auch JvNs Überzeugung wiederspiegelt (siehe 1.5), entspricht der These der “revisionistische Schule“ der amerikanischen Historiker, die besagt, dass die Bomben abgeworpfen wurden, um die Sowjetunion einzuschüchtern. Nach dem Abwurf der Atombombe und der beginnenden Diskussion in der welt weiten Öffentlichkeit, veränderten sich auch in Princeton die Standpunkte der Akademiker zu Verantwortung und Ethik der Wissenschaft. Robert Jungk besuchte das Institute for Advanced Study (IAS) und berichtet in seinem Buch “Die Zukunft hat schon begonnen“ von den dortigen Debatten um die Frage der Schuld der Wissenschaften. Er zitiert JvN mit nachdenklichen, selbstkritischen Worten [44] : „Wir Gelehrte waren ‘Apostel’ und sind ‘Bischöfe’ geworden, wir haben mit den Mächtigen paktiert und uns von ihnen für ihre Ziele einspannen lassen. Darunter leidet die reine Heilsbotschaft der Wissenschaft, die nichts als Wahrheit will.“ Dieses ist ein außergewöhnliches Zitat. In keiner der zur Verfügung stehenden Quellen ist eine solche, an Selbstzweifel grenzende Äußerung nochmals belegt. In dem Buch des umstrittenen Autors Robert Jungk ist keine Angabe über den Zeitpunkt zu finden, an dem JvN das Zitat geäußert haben soll. Eine Begründung für diesen Sinneswandel zu finden, ist dadurch erschwert. Möglicherweise war das spätere Verfahren gegen R. Oppenheimer einer der Gründe für JvNs Aussage.
Die unmittelbaren Wirkungen einer atomaren Explosion waren damals bereits wohlbekannt und ausführlich dokumentiert. Sowohl Hitze als auch Neutronen und Gammastrahlung, Druckwellen und Feuerstürme hatten die Wissenschaftler während der Tests studiert. Entsprechend den Maßgaben seiner Arbeit befürwortete JvN atomare Tests. In der zunehmend unter Wissenschaftlern diskutierten Frage, welche Auswirkungen Radioaktivität und insbesondere radioaktiver Niederschlag habe, machte er seine Meinung deutlich. Er vertrat den Standpunkt, daß Risiken nicht vermeidbar seien. An Lewis Strauss, Commissioner der AEC, schrieb JvN in einem Memorandum [34]: ”The present vague fear and vague talk regarding the adverse worldwide effects of general radioactive contamination are all geared to the concept that any general damage of life must be excluded … Every worthwhile activity has a price, both in terms of certain damage and of potential damage of risks and the only question is, whether the price is worth paying … Is the price worth paying? For the U.S. it is. For another country, with no nuclear industry and a neutralistic attitude in world politics it may not be.“
Der kalte Krieg und die “ Superbombe“
Mit dem Bombenabwurf hatten die Amerikaner deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie eine starke Position in den Nachkriegsverhandlungen gegenüber der Sowjetunion einnehmen würden. JvN teilte die Ansicht, daß die Sowjetunion unbedingt als militärischer Gegner anzusshen sei : “We where involved in a triangular war, where two of our enemies had done … the nice thing of fighting each other“ [3]. Für ihn war klar, daß es bald nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer militärischen Auseinandersetzung mit der UdSSR kommen würde [45] : „Russia was traditionally the enemy. I think you will find, generally speaking, among Hungarians an emotional fear and dislike of Russia.“ Aufgrund dieser politischen Ansichten nahm er den Einsatz der Atombombe nicht nur als Notwendigkeit hin, sondern unterstützte aktiv die militärischen Bemühungen durch seine Mitarbeit an der Bombe und im “Target Committee”. Seine politischen Motive beinhalteten darüberhinaus die Idee eines atomaren Präventivkrieges gegen die Sowjetunion. Freeman J . Dyson schreibt darüber in seiner Rezension des Buches von S. Heims [46]: “Da ist also die Tatsache, daß von Neumann in den späten 1940er und frühen 1950er für einen Präventivkrieg gegen die Sowjetunion eintrat. Der Ausdruck ‘Präventivkrieg’ vermittelt heutzutage die Vorstellung eines übergeschnappten Militarismus.“3 Brian Easle
[41] schreibt dagegen : “Von Neumanns Idee eines atomaren Überraschungsangriffs auf die Sowjetunion, der einen potentiellen künftigen Atomkrieg zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten verhindern sollte, kommt meines Erachtens der Beschreibung ‘verrückt’ und/oder ‘verbrecherisch’ recht nahe. Wie die nukleare Vernichtung eines Landes und seiner Bevölkerung jemals als ‘entschlossenes Vorbeugen’ gerechtfertigt werden kann, leuchtet mir nicht ein.“
Mit dem Beginn des Kalten Krieges sollten gegenüber dem Erzfeind Rußland die defensiven Verteidigungs möglichkeiten der USA gestärkt werden. Anfang der fünfziger Jahre beschloß die amerikanische Führung zudem, die Entwicklung strategischer Langstreckenraketen zu forcieren. Zu diesem Zweck sollten beratende Komitees gegründet werden. JvN spielte als anerkannter Stratege eine Schlüsselrolle in diesen Gremien. Er nahm längst die Sowjetunion und deren Waffenlaboratorien als Bedrohung wahr. S. Ulam, freundschaftlich mit JvN verbunden, erinnert sich [13] : “Johnny and others were apprehensive about Russia’s ability to obtain or to develop nuclear bombs.“ Obgleich S. Ulam zugibt, daß die politische Unterscheidung zwischen “Falken“ und “Tauben“ noch nicht gebräuchlich war, schreibt er über JvN [13] : “He was quite hawkish at that time… he was for a Pax Americana more than some of our other physicist friends. He also foresaw early that the essential military problems would shift from the bombs them selves and their size and shapes to ways to deliver them that is to say, to rocketry.“ Ab 1951 nahm JvN gemeinsam mit Ulam, Teller und George Gamow an den Treffen zum ICBMProgramm (Intercontinental Ballistic Missile) teil. Die Ergebnisse dieser Gespräche wurden zu der Zeit vom Pentagon geheimgehalten. 1953 rekrutierte Trevor Gard ner , Special Assistent des Secretary of the Air Forces for Research and Development, JvN für das Projekt der Air Force. Die Aufgabe des zu gründenden Komitees sollte die Evaluation des ICBMProgramms der Air Force sowie die Analyse des technologischen Fortschrittes von potientiellen Feinden, insbesondere Rußlands, sein. Für die durch die Komiteemitglieder festgestellten Dinge sollten den amerikanischen Militärs Lösungen vorgeschlagen werden. JvN wurde Vorsitzender des Air Force Strategic Missiles Evaluation Committee, welches gemeinhin als “Von Neu mann Committee” oder “Teapot Committee” bekannt wurde. JvN schlug vor, Raketen für die Beförderung nuklearer Waffen zu nutzen. Die Mitglieder diskutierten die maximale Größe einer Wasserstoffbombe, die von einem Bomber oder einer Rakete transportiert werden könnte. Sie kamen zu dem Schluß, daß ein B52 Bomber eine Bombe mit einer Sprengkraft von 20 Megatonnen TNT ohne weiteres befördern könnte, jedoch Raketen wegen ihrer Schnelligkeit und Unbemanntheit vorzuziehen seien. JvN befürchtete für die späten fünfziger Jahre eine Verteidigungslücke in der amerikanischen Abwehr, sollten die Raketenprogramme nicht energisch vorangetrieben werden. Er sah deshalb “eine ungewöhnliche Dringlichkeit für die Verfügbarkeit von strategischen Raketen“ [11]. Seine Überlegungen beeinflußten den Fortgang und die Richtung der Entwicklung neuer Interkontinentalraketen erheblich. Die Militärs räumten den ICBMProgrammen fortan höchste Priorität ein. Trevor Gardner wollte die erfolgreiche Arbeit des “Teapot Committee” fortführen und fragte JvN, ob er bereit sei, auch den Vorsitz des Atlas Scientific Advisory Committee (später ICBM Scientific Advisory Committee) zu übernehmen. Zu dieser Zeit wurde das Raketensystem “Atlas“ entwickelt. JvN akzeptierte und half mit seiner Arbeit im Komitee, die Entwicklung des Atlasprogramms zu überwachen und zu beschleunigen. Er vertrat die Meinung, daß zeitgleich mehrere Raketenbauprojekte gestartet werden sollten, denn dies würde das Zusammenspiel und gleichzeitig die Konkurrenz der Systeme fördern. Im Sommer 1955 erläuterten JvN und Trevor Gardner ihre Vorstellungen Präsident Eisenhower . Die Vorschläge wurden daraufhin von den Militärs umgesetzt und es entstanden miteinander in Wettbewerb stehende ICBMProgramme, die bis zum Ende des Kalten Krieges fortgeführt wurden. Die insgesamt sechs verschiedenen Raketentypen sollten ein “Gleichgewicht des Schreckens“ [11] im Kalten Krieg garantieren.
Präsident Harry S. Truman unterzeichnete am 1. August 1946 den Atomic Energy Act. Fast ein Jahr nach Ende des Krieges beschloß der amerikanische Kongreß hiermit, die Weiterentwicklung und Kontrolle der Atomforschung in die Hände des AEC zu legen. Dort wurde unter den Experten die Machbarkeit einer thermonuklearen Bombe diskutiert. Das General Advisory Committee (GAC), das neunköpfige wissenschaftliche Beratungskomitee der AEC, und die Mehrheit der Mitglieder votierten gegen den Bau der Bombe und für die Aufgabe des Projektes : “Die tödliche Gefahr für die Menschheit, die dieser Vorschlag [die thermonukleare Waffe zu entwickeln] in sich birgt, wiegt schwerer als jeder denkbare militärische Nutzen.“ (Bericht des AEC vom Oktober 1949). Weiter ist zu lesen : “[the bomb] might become a weapon of genocide“ [12]. JvN gehörte zu der Minderheit unter den Wissenschaftlern, die als Unterstützer des Wasserstoffbombenbaus hervortraten. Edward Teller berichtet [10] : „Johnny had been a strong supporter of the hydrogen bomb ever since learning about it.“ Die Politiker, getrieben von der Furcht, die Sowjetunion könnte ihrer seits eine solche Waffe entwickeln, entschieden sich für weitere Forschungen und unterstützten das Projekt. Präsident Truman wies mithin die Empfehlungen des GAC zurück und ordnete im März 1950 die Entwicklung der sogenannten “Super Bombe“ an. In JvN fand er einen ausdrücklichen Befürworter : “Johnny and I had a common concern about the international situation. With Stalin in the Kremlin, neither of us felt comfortable with doing less than we possibly could. In particular, Johnny was as much interested in the hydrogen bomb as I was“ [10]. Das Projekt zum Bau der Wasserstoffbombe sollte JvN einige Jahre intensiv beschäftigen. Ebenso wie den Bau der Atombombe unterstützte JvN von Beginn an die Entwicklung der Wasserstoffbombe. Fragen der Moral und Verantwortung spielten offenbar eine untergeordnete Rolle in seinem strategischen Denken. R. Oppen heimer erinnert sich an ein Gespräch mit ihm, in dem die Männer über die politischen und strategischen Konsequen zen der Entwicklung einer thermonuklearen Waffe sprachen [45] : “I remember von Neumann saying … ‘I believe there is no such thing as saturation. I don’t think any weapon can be too large. I have always been a believer in this.’ He was in favor of going ahead with it.“ Wie bei den meisten beteiligten Wissenschaftlern war für JvN die wissen schaftlichtechnische Herausforderung einer der Gründe für die engagierte Mitarbeit am thermonuklearen Programm. Seine Teilnahme hatte eine Sogwirkung auf viele junge Wissenschaftler, die zu dem Programm kamen, um mit den berühmten Kollegen zusammenarbeiten zu können. Herbert York, damals gerade 30jährig, erinnert sich : “[JvN], Edward Teller oder Hans Bethe waren für ihn legendäre und doch leibhaftige Helden“ [47]. Vom 18. bis 20. April 1946 kamen die wichtigsten Wissenschaftler und Berater von Los Alamos zu einer geheimen Konferenz zusammen. Neben E. Teller und S. Ulam war unter ihnen auch JvN. Sie wollten das bisherige Stadium der Entwicklung der Wasserstoffbombe auswerten und Pläne für das weitere Vorgehen entwerfen. Die Aufzeichnungen dieser sogenannten ”Super Confer ence“ geben den Gedankenaustausch und die Ideen für die zukünftige Entwicklung wieder [45]: „Dr. von Neumann suggested the ignition of a ‘Super’ bomb through the employment of an implosion process.“ Er und der später als Spion entlarvte Physiker Klaus Fuchs entwickelten diese Idee nach der Konferenz weiter und meldeten am 28. Mai 1946 ein gemeinsames Patent an. Im später herausgegebenen Report der Konferenz stellen die Teilnehmer fest [45]: „It is likely that a superbomb can be constructed and will work. The detailed design submitted to the conference was judged on the whole workable.“
Der Bau eines eigenen Computers in den Versuchsanlagen war zu dieser Zeit bereits beschlossen. JvN hatte begonnen, am IAS den JONIAC zu bauen (vgl. 3.1). Eine exakte Kopie dieses Computers sollte für Los Alamos hergestellt werden. Da jedoch die Konstruktion beider Maschinen weit hinter dem Zeitplan verlief, wurde zunächst eine Berechnung per Hand versucht. JvN schätzte den Aufwand dieser Kalkulation auf hundert Handrechner über einen Zeitraum von vier Jahren. Die Antwort auf die Frage, ob sich die Wasserstoffbombe entzünden würde, erbrachte eine Berech nung am JONIAC im Jahr 1950. In [48]zu lesen : “ Von Neumann … had the idea that one of the calculations needed for the thermonuclear reaction should be tried on the I.A.S. computer. The computation required was monumental … just to find out whether the reaction would propagate as desired. So the first problem was to figure out whether the H bomb would explode. The answer was yes.“ Nachdem die Frage der Machbarkeit beantwortet war, mußte auch der erste Test der neuen Bombe durch umfangreiche Berechnungen vorbereitet werden. Wieder half ein Rechner wes entlich bei der Lösung der mathematischen Probleme, die mit der Herstellung der ersten Wasserstoffbombe verbunden waren. Im Frühjahr 1952 wurde der LosAlamosComputer mit dem Namen MANIAC (Mathematical and Numeric Integrator and Calculator, von Kollegen scherzhaft “Metropolis And Neumann Invent Awful Contraption” genannt) fertiggestellt. Schon im Herbst desselben Jahres bewies der ”Ivy Mike Test“ auf dem Atoll Eniwetok im Pazifik die Richtigkeit der Kalkulationen und damit auch der Theorie E. Tellers. T. E. Murray, Leiter des AEC, war Augen zeuge der Detonation, und beschrieb seinen Eindruck folgendermassen[49] : “Wenn du … mit mir draußen im Pazifik, in unserem Testgebiet bei Eniwetok, gewesen wärst, du würdest bestimmt nicht daran zweifeln, daß die Menschheit nunmehr über die Mittel verfügt, die menschliche Rasse auszulöschen.“ Die Explosionskraft der Wasserstoffbombe war weit größer als die der Atombombe.
Das thermonukleare Monopol der Amerikaner hielt jedoch nur bis zum 8. August 1953, als in der damaligen Sowjet union eine eigene “Super “ gezündet wurde. Vier Monate später hielt Präsident Eisenhower vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen eine vielzitierte Rede, und betonte nun die für die Zukunft geplante zivile Nutzung der Atomkraft [50]: „The United States knows that peaceful power from
atomic energy is no dream of the future. That capability, already proved, is here now today … this greatest of destructive forces can be developed into a great boon for the benefit of all mankind.“
Seit Januar 1947 hatte Oppenheimer als Vorsitzender des GAC gearbeitetet. Er lehnte jedoch eine erneute Berufung zur Weiterarbeit an der staatlichen Bombenforschung in Los Alamos ab und ging zurück nach Princeton, um „an der Bewahrung der guten Dinge zu arbeiten, für die der Mensch lebt.“[44]. Oppenheimers anhaltend ablehnender Stand punkt gegenüber dem WasserstoffbombenProjekt führte zu ersten Mutmaßungen bezüglich seiner Loyalität. Die Militärs und einige Wissenschaftler hielten ihn zunehmend für ein Sicherheitsrisiko und diffamierten ihn als Kommunisten. Obwohl der als Sohn reicher, deutschstämmiger New Yorker Juden geborene Oppenheimer nie Mit glied der kommunistischen Partei geworden war, verweigerten ihm die Militärs die Sicherheitsunbedenklichkeits erklärung. Es kam ab dem 12. April 1954 zu einer vierwöchigen Anhörung. Dabei wurden vierzig Zeugen, meist Wissenschaftler, die mit Oppenheimer gearbeitet hatten, gehört. Trotz seiner Vorbehalte gegenüber dem Kommunismus befürwortete JvN die antikommunistische Kampagne von Senator Joseph McCarthy nicht. Obwohl Oppenheimer gegen das Wasserstoffbombenprojekt opponierte, welches JvN seinerseits energisch förderte, unter stützte er ihn durch seine Aussage und durch persönliche, sowie finanzielle Hilfen. In seiner Erklärung versicherte er, daß Oppenheimer höchst zuverlässig und vertrauenswürdig sei. S. Ulam schreibt über JvN [13]: ”Even though [JvN] did not especially like Oppenheimer personally, he defended him with great objectivity and gave very correct, coura geous, and intelligent testimony.“ E. Teller , der den Ausgang des Verfahrens maßgeblich beeinflußte, ließ sich jedoch von seiner persönlichen Abneigung gegen Oppenheimer leiten. Er antwortete auf die Frage danach, ob Oppenheimer ein Sicherheitsrisiko darstelle [51] : ”I thoroughly disagreed with him in numerous issues and his actions frankly appeared to me confused and complicated. To this extent I feel that I would like to see the vital interests of this country in hands which I understand better, and therefore trust more.“ Sein Ziel war es, den Widerstand gegen das Bombenprojekt, dessen Galionsfigur Oppenheimer geworden war, zu brechen. Und er gewann: Mit einem Votum von vier zu eins wurde Oppenheimer die Unbedenklichkeitserklärung verweigert. Für den entschiedenen Gegner des Wasserstoffbombenbaus endeten damit seine Einflußmöglichkeiten auf die Atompolitik.
Die politische Karriere
JvN und Eisenhower bei der Verleihung der “Medal of Freedom”, 1956
Die “Medal of Freedom” wurde damals vom Präsidenten verliehen und war die höchste zivile Auszeichnung für besondere Verdienste um das Land während des Kriegs. Diese Anerkennung wurde von Präsident Truman 1945 eingeführt.
1963 hat John F. Kennedy wieder begonnen diese Medaille zu vergeben, aber an Menschen, die während der Friedenszeit ganz besonders dem Vaterland in zivilen Dingen gedient haben. Source unknown.

JvNs Zielstrebigkeit, seine genialen mathematischen Fähigkeiten, seine Erfahrungen in der nuklearen Forschung, besonders aber seine gute Beziehung zu Admiral Lewis Strauss verhalfen ihm 1955 zu einer Anstellung als Com missioner der AEC, einem der höchsten Posten in den Vereinigten Staaten. JvN zögerte das Angebot seines Freundes und politischen Mentors Strauss, der ihn zunehmend bedrängte, anzunehmen. S. Ulam berichtet, die Entscheidung hätte JvN schlaflose Nächte bereitet. Er erinnert sich an ein Gespräch mit ihm über den zukünftigen Posten [13] : “He had profound reservations about his acceptance because of the ramifications of the Oppenheimer Affair. He knew that the majority of scientists did not like Admiral Strauss’s actions and did not like Johnny’s pragmatic and rather pro military views nor did they appreciate his association with the atomic energy work in general and with Los Alamos in particular.“ Entgegen den Ratschlägen einiger befreundeter Weggefährten entschloß sich JvN jedoch, den 5Jahres Vertrag zu akzeptieren. S. Ulam erinnert sich [13] : ”He was flattered and proud that although foreign born he would be entrusted with a high governmental position of great potential influence in directing large areas of technology and science.“ JvN wurde am 15. Mai 1955 von Präsident Eisenhower zu einem von fünf Commissionern der AEC ernannt. Da diese Tätigkeit hauptberuflich war, verlegte JvN seinen Wohnsitz nach Washington. Er diente einer Kommission, die Oppenheimer so beurteilte [45] : ”The principal job of the Commission was to provide atomic weapons and good atomic weapons and many atomic weapons.“
JvN hatte den Höhepunkt seiner politischen Laufbahn erreicht. Seine Position war nicht nur einflußreich, sondern auch weitgehend unabhängig von den politischen Machthabern. S. Heims [3] schreibt : “With a fixed fiveyear term, a commissioner was relatively invulnerable to the president’s or Congress’s whim, and his actions were largely secret from the electorate.“ Politisch beeinflußt wurde JvN durch Lewis Strauss, der von 1953 bis 1958 Vorsitzender der AEC war. Wie S. Ulam feststellte, waren die Männer befreundet und JvN hatte seinerseits Einfluß auf Strauss [13] : “As a friend of his [JvN] and having pressed him to accept the offer, Strauss would be obligated to support his views and ideas.“ Dies sollte L. Strauss nicht schwerfallen, gehörten er und JvN doch zum selben politischen Lager. S. Heims charakterisiert L. Strauss politische Einstellung “as Republican, militaristic, and militantly anticommunist“ [3]. Die Berufung JvNs in die AEC war Teil eines politischen Schachzugs. Strauss hatte sich die Kommission nach seinen Plänen geformt. Davon profitierte auch JvN. “Strauss’s political good fortune also gave von Neumann a direct link to the center of nuclear weapons policymaking“ [3].
JvN konnte jedoch das neue Amt nicht mehr lange ausüben. Eine Krebserkrankung zwang ihn ab Januar 1956 in den Rollstuhl, und drei Monate später zu einem dauerhaftem Krankenhausaufenthalt im Walter Reed Hospital in Washing ton. Die Krankheit rührte wahrscheinlich vom leichtfertigen Umgang mit der Strahlung während der Atom
bombentests her. Poundstone bemerkte in seinem Buch die Wisenschaftler, die direkt Augenzeugen von atomaren Explosionen waren [34] : ”A number of physicists associated with the bomb succumbed to cancer at relatively early ages.“ Selbst im Krankenbett war von Neumann noch ein Ratgeber für die Armee. Es kam nicht nur zu mehreren Besuchen hochrangiger Militärs, ihm wurde auch ein “Gehilfe” zur Seite gestellt. Dieser sollte verhindern, daß geheime Informationen preisgegeben wurden. Es gab Befürchtungen, JvN könne durch seine Krankheit als geheim klassifiziertes Wissen offenbaren.
Ein persönlicher Blick auf JvN von Stephen Wolfram
Wir zitieren im Folgenden [15]. Der Titel lautet “John von Neumann’s 100th Birthday (Posted to the NKS Forum December 28, 2003)“ :
“Today (December 28, 2003) would have been John von Neumann’s 100th birthday if he had not died at age 54 in 1957, and that gives me an excuse today to write a little about him. (I would have liked to spend longer on this, but December 28 only lasts so long, and I have many other things to do.)
I’ve been interested in von Neumann for many years not least because his work touched on some of my most favorite topics. He is mentioned in 12 separate places in my book second in number only to Alan Turing, who appears 19 times. (See www.wolframscience.com/nks/index/names/tz.html.)
I always feel that one can appreciate peoples’ work better if one understands the people themselves better. And from talking to many people who knew him, I think I’ve gradually built up a decent picture of John von Neumann as a man. He would have been fun to meet. He knew a lot, was very quick, always impressed people, and was lively, social and funny.
One video clip of him has survived. In 1955 he was on a television show called “Youth Wants to Know”, which today seems painfully hokey. Surrounded by teenage kids, he is introduced as a commissioner of the Atomic Energy Commis sion which in those days was a big deal. He is asked about an exhibit of equipment. He says very seriously that it’s mostly radiation detectors. But then a twinkle comes into his eye, and he points to another item, and says deadpan “except this, which is a carrying case”. And that’s the end of the only video record of John von Neumann that exists. Some scientists (such as myself) spend most of their lives pursuing their own grand programs, ultimately in a fairly isolated way. John von Neumann was instead someone who always liked to interact with the latest popular issues and the people around them and then contribute to them in his own characteristic way.
He worked hard, often on many projects at once, and always seemed to have fun. In retrospect, he chose most of his topics remarkably well. He studied each of them with a definite practical mathematical style. And partly by being the first person to try applying serious mathematical methods in various areas, he was able to make important and unique contributions.
But I’ve been told that he was never completely happy with his acheivements because he thought he missed some great discoveries. And indeed he was close to a remarkable number of important mathematicsrelated discoveries of the twentieth century: Goedel’s theorem, Bell’s inequalities, information theory, Turing machines, computer languages as well as my own more recent favorite core NKS discovery of complexity from simple rules. But somehow he never quite made the conceptual shifts that were needed for any of these discoveries.
There were, I think, two basic reasons for this. First, he was so good at getting new results by the mathematical methods he knew that he was always going off to get more results, and never had a reason to pause and see whether some different conceptual framework should be considered. And second, he was not particularly one to buck the system: he liked the social milieu of science and always seemed to take both intellectual and other authority seriously. By all reports, von Neumann was something of a prodigy, publishing his first paper (on zeros of polynomials) at the age of 19. By his early twenties, he was established as a promising young professional mathematician working mainly in the thenpopular fields of set theory and foundations of math. (One achievement was alternate axioms for set theory see the NKS book, page 1155.)
Like many good mathematicians in Germany at the time, he worked on David Hilbert’s program for formalizing mathematics, and for example wrote papers aimed at finding a proof of consistency for the axioms of arithmetic. But he did not guess the deeper point that Kurt Goedel discovered in 1931: that actually such a proof is fundamentally
impossible. I’ve been told that von Neumann was always disappointed that he had missed Godel’s theorem. He certainly knew all the methods needed to establish it (and understood it remarkably quickly once he heard it from Godel). But somehow he did not have the brashness to disbelieve Hilbert, and go looking for a counterexample to Hilbert’s ideas.
In the mid1920s formalization was all the rage in mathematics, and quantum mechanics was all the rage in physics. And in 1927 von Neumann set out to bring these together by axiomatizing quantum mechanics. A fair bit of the formalism that von Neumann built has become the standard framework for any more mathematical exposition of quantum mechanics. But I must say that I have always thought that it gave too much of an air of mathematical definiteness to ideas (particularly about quantum measurement) that are in reality depend on all sorts of physical details. And indeed some of von Neumann’s specific axioms turned out to be too restrictive for ordinary quantum mechanics obscuring for a number of years the phenomenon of entanglement, and later of criteria such as Bell’s inequalities.
But von Neumann’s work on quantum mechanics had a variety of fertile mathematical spinoffs, and particularly what are now called von Neumann algebras have recently become popular in mathematics and mathematical physics. Interestingly, von Neumann’s approach to quantum mechanics was at first very much aligned with traditional calculus based mathematics investigating properties of Hilbert spaces, continuous operators, etc. But gradually it became more focused on discrete concepts, particularly early versions of “quantum logic”. In a sense von Neumann’s quantum logic ideas were an early attempt at defining a computational model of physics. But he did not pursue this, and did not go in the directions that have for example led to modern ideas of quantum computing.
By the 1930s von Neumann was publishing several papers a year, on a variety of popular topics in mainstream mathematics, often in collaboration with contemporaries of significant later reputation (Wigner, Koopman, Jordan, Veblen, Birkhoff, Kuratowski, Halmos, Chandrasekhar, etc.). Von Neumann’s work was unquestionably good and innovative, though very much in the flow of development of the mathematics of its time. Despite von Neumann’s early interest in logic and the foundations of math, he (like most of the math community) moved away from this by the mid1930s. In Cambridge and then in Princeton he encountered the young Alan Turing even offering him a job as an assistant in 1938. But he apparently paid little attention to Turing’s classic 1936 paper on Turing machines and the concept of universal computation, writing in a recommendation letter on June 1, 1937 that “[Turing] has done good work on … theory of almost periodic functions and theory of continuous groups”.
As it did for many scientists, von Neumann’s work on the Manhattan Project appears to have broadened his horizons, and seems to have spurred his efforts to apply his mathematical prowess to problems of all sorts not just in tra ditional mathematics. His pure mathematical colleagues seem to have viewed such activities as a peculiar and somewhat suspect hobby, but one that could generally be tolerated in view of his respectable mathematical creden tials. At the Institute for Advanced Study in Princeton, where von Neumann worked, there was strain, however, when he started a project to build an actual computer there. Indeed, even when I worked at the Institute in the early 1980s, there were still pained memories of the project. The pure mathematicians at the Institute had never been keen on it, and the story was that when von Neumann died, they had been happy to accept Thomas Watson of IBM’s offer to send a truck to take away all of von Neumann’s equipment. (Amusingly, the 6inch onoff switch for the computer was left behind, bolted to the wall of the building, and has recently become a prized possession of a computer industry acquain tance of mine.)
I had some small interaction with von Neumann’s heritage at the Institute in 1982 when the thendirector (Harry Woolf) was recruiting me. (Harry’s original concept was to get me to start a School of Computation at the Institute, to go along with the existing School of Natural Sciences and School of Mathematics. But for various reasons, this was not what happened.) I was concerned about intellectual property issues, having just had some difficulty with them at Caltech. Harry’s response that he attributed to the chairman of their board of trustees was: “Look, von Neumann developed the computer here, but we insisted on giving it away; after that, why should we worry about any intellectual property rights?”. (The practical result was a letter disclaiming any rights to any intellectual property that I produced at the Institute.)
Among several of von Neumann’s interests outside of mainstream pure mathematics was his attempt to develop a mathematical theory of biology and life (see the NKS book, page 876). In the mid1940s there had begun to be particularly from wartime work on electronic control systems quite a bit of discussion about analogies between “natural and artificial automata”, and “cybernetics”. And von Neumann decided to apply his mathematical methods to
this. I’ve been told he was particularly impressed by the work of McCullough and Pitts on formal models of the analogy between brains and electronics (see the NKS book, page 1099). (There were undoubtedly other influences too: John McCarthy told me that around 1948 he visited von Neumann, and told him about applying information theory ideas to thinking about the brain as an automaton; von Neumann’s main response at the time was just “write it up!”.) Von Neumann was in many ways a traditional mathematician, who (like Turing) believed he needed to turn to partial differential equations in describing natural systems. I’ve been told that at Los Alamos von Neumann was very taken with electrically stimulated jellyfish, which he appears to have viewed as doing some kind of continuous analog of the information processing of an electronic circuit. In any case, by about 1947, he had conceived the idea of using partial differential equations to model a kind of factory that could reproduce itself, like a living organism.
Von Neumann always seems to have been very taken with children, and I am told that it was in playing with an erector set owned by the son of his game theory collaborator Oskar Morgenstern that von Neumann realized that his selfreproducing factory could actually be built out of discrete roboticlike parts. (There was already something of a tradition of building computers out of Meccano and indeed for example some of Hartree’s early articles on analog computers appeared in Meccano Magazine.) An electrical engineer named Julian Bigelow, who worked on von Neumann’s IAS computer project, pointed out that 3D parts were not necesary, and that 2D would work just as well. (When I was at the Institute in the early 1980s Bigelow was still there, though unfortunately viewed as a slightly peculiar relic of von Neumann’s project.) Stan Ulam told me that he had independently thought about making mathe matical models of biology, but in any case, around 1951 he appears to have suggested to von Neumann that one should be able to use a simplified, essentially combinatorial model based on something like the infinite matrices that Ulam had encountered in the socalled Polish Book of math problems to which he had contributed. The result of all this was a model that was formally a twodimensional cellular automaton. Systems equivalent to twodimensional cellular automata were arising in several other contexts around the same time (see the NKS book, page 876). von Neumann seems to have viewed his version as a convenient framework in which to construct a mathematical system that could emulate engineered computer systems especially the EDVAC on which von Neumann worked.
In the period 19523 von Neumann sketched an outline of a proof that it was possible for a formal system to support self reproduction. Whenever he needed a different kind of component (wire, oscillator, logic element, etc.) he just added it as a new state of his cellular automaton, with new rules. He ended up with a 29state system, and a 200,000 cell configuration that could reproduce itself. (von Neumann himself did not complete the construction. This was done in the early 1960s by a former assistant of von Neumann’s named Arthur Burks, who had left the IAS computer project to concentrate on his interests in philosophy, though who maintains even today an interest in cellular automata.) From the point of view of NKS, von Neumann’s system now seems almost grotesquely complicated. But von Neu mann’s intuition told him that one could not expect a simpler system to show something as sophisticated and bio logical as self reproduction. What he said was that he thought that below a certain level of complexity, systems would always be “degenerative”, and always generate what amounts to behavior simpler than their rules. But then, from seeing the example of biology, and of systems like Turing machines, he believed that above some level, there should be an “explosive” increase in complexity, with systems able to generate other systems more complex than themselves. But he said that he thought the threshold for this would be systems with millions of parts.Twentyfive years ago I might not have disagreed too strongly with that. And certainly for me it took several years of computer experimen tation to understand that in fact it takes only very simple rules to produce even the most complex behavior. So I do not think it surprising or unimpressive that von Neumann failed to realize that simple rules were enough. Of course, as one often realizes in retrospect, he did have some other clues. He knew about the idea of generating pseudorandom numbers from simple rules, even suggesting the “middle square method” (see NKS page 975.) He had the beginnings of the idea of doing computer experiments in areas like number theory. He analysed the first 2000 digits of pi and e, computed on the ENIAC, finding that they seemed random though making no comment on it (see the NKS book, page 912). (He also looked at ContinuedFraction[2^(1/3)] ; see the NKS book, page 914.) I have asked many people who knew him why von Neumann never considered simpler rules. Marvin Minsky told me that he actually asked von Neumann about this directly, but that von Neumann had been somewhat confused by the question. It would have been much more Ulam’s style than von Neumann’s to have come up with simpler rules, and Ulam indeed did try making a onedimensional analog of 2D cellular automata, but came up not with 1D cellular automata, but with a curious numbertheoretical system (see the NKS book, page 908).
In the last ten years of his life, von Neumann got involved in an impressive array of issues. Some of his colleagues seem to have felt that he spent too little time on each one, but still his contributions were usually substantial some times directly in terms of content, and usually at least in terms of lending his credibility to emerging areas. He made
mistakes, of course. He thought that each logical step in computation would necessarily dissipate a certain amount of heat, whereas in fact reversible computation is in principle possible. He thought that the unreliability of components would be a major issue in building large computer systems; he apparently did not have an idea like errorcorrecting codes. He is reputed to have said that no computer program would ever be more than a few thousand lines long. He was probably thinking about proofs of theorems but did not think about subroutines, the analog of lemmas. Von Neumann was a great believer in the efficacy of mathematical methods and models, perhaps implemented computers. In 1950 he was optimistic that accurate numerical weather forecasting would soon be possible (see the NKS book page 1132). In addition, he believed that with methods like game theory it should be possible to understand much of economics and other forms of human behavior (see the NKS book page 1135). Von Neumann was always quite a believer in using the latest methods and tools (I’m sure he would have been a big Mathematica user today).
He typically worked directly with one or two collaborators, sometimes peers, sometimes assistants, though he main tained contact with a large network of scientists. (A typical communication was a letter he wrote to Alan Turing in 1949, in which he asks “What are the problems on which you are working now, and what is your program for the immediate future?”.) In his later years he often operated as a distinguished consultant, brought in by the government, or other large organizations. His work was then often presented as a report, that was accorded particular weight because of his distinguished consultant status. (It was also often a good and clear piece of work.) He was often viewed a little ambivalently as an outsider in the fields he entered positively because he brought his distinction to the field, negatively because he was not in the clique of experts in the field. Particularly in the early 1950s, von Neumann became deeply involved in military consulting, and indeed I wonder how much of the intellectual style of cold war
U.S. military strategic thinking actually originated with him. He seems to have been quite flattered that he called upon to do this consulting, and he certainly treated the government with considerably more respect than many other scientists of his day. Except sometimes in his exuberence to demonstrate his mathematical and calculational prowess, he seems to have always been quite mature and diplomatic. The transcript of his testimony at the Oppenheimer security hearing certainly for example bears this out.
Nevertheless, von Neumann’s military consulting involvements left some factions quite negative about him. It’s sometimes said, for example, that von Neumann might have been the model for the sinister Dr. Strangelove character in Stanley Kubrick’s movie of that name (and indeed von Neumann was in a wheelchair for the last year of his life). And vague negative feelings about von Neumann surface for example in a typical statement I heard recently from a science historian of the period that “somehow I don’t like von Neumann, though I can’t remember exactly why” . I recently met von Neumann’s only child his daughter Marina, who herself has had a distinguished career, mostly at General Motors. She reinforced my impression that until his unpleasant final illness, John von Neumann was a happy and energetic man, working long hours on mathematical topics, and always having fun. She told me that when he died, he left a box that he directed should be opened fifty years after his death. What does it contain? His last sober predictions of a future we have now seen? Or a joke like a funny party hat of the type he liked to wear? It’ll be most interesting in 2007 to find out.“
JvN und die Mathematik
Eine kurze Vorgeschichte zur ToG. Die ToG bündelte zwei wesentliche Strömungen in der Ökonomie und der Mathematik. Einerseits waren es Arbeiten in der Ökonomie wie die von Cournot, Edgeworth, Böhm-Bawerk und van Zeuthen, die sich mit dem strategischen Verhalten von Marktteilnehmern beschäftigten [52]. Zum anderen waren es Modelle von Mathematikern wie Lanches ter (1916) [53] und Richardson (1919) [54], die (leider bis 1950 völlig unbeachtet) die Thematik von Krieg und Frieden behandelten. Hervorzuheben ist E. Borel, der 1921 [55], 1924 [56] und 1927 [57] eine Reihe von Arbeiten präsentierte, in denen er bereits die Konzepte der Randomisierung durch gemischte Strategien und der Eliminierung schlechter Strategien vorstellte und zu speziellen strategischen Spielen Lösungen fand. E. Borel brachte schon zu dieser Zeit seine Überzeugung zum Ausdruck, dass die Theorie der Spiele prädestiniert sei für ökonomische und militärische Anwendungen [58].
JvN formulierte 1928 das Minimax Theorem für das 2PersonenNullsummenspiel mit einer endlichen Anzahl von Strategien und formulierte den Beweis mithilfe des Brouwerschen Fixpunksatzes [25]. Damit konnte er zugleich ein von E. Borel aufgezeigtes Problem lösen. Ihre gemeinsame Korrespondenz dazu veröffentlichte E. Borel in [26]. JvN kannte selbstverständlich auch den Beweis von Zermelo [59] über die Existenz einer Lösung des Schachspiels, da er beim Briefverkehr mit Zermelo einen darin verborgenen Fehler korrigieren konnte [60]. E. Borel beschäftigte sich in den dreißiger Jahren weiterhin mit spieltheoretischen Themen [61]. Sein Schüler J .Ville formulierte 1938 nicht nur einen nichttopologischen Beweis zur Arbeit [25], sondern erweiterte JvNs Minimaxtheorem auf Spiele mit einem Kontinuum möglicher Strategien. Eben diese Arbeit diese sollte in der ToG eine wichtige Rolle spielen (vgl. 2.2). OM und JvN zitieren darin auch [61], aber keine früheren Arbeiten von E. Borel.
JvNs Interesse an der Spieltheorie während der dreißiger Jahre kann als sporadisch, aber regelmäßig wiederkehrend bezeichnet werden. Im April 1937 berichtete der “Science News Letter“ von einem Vortrag JvNs in Princeton über das SteinScherePapierSpiel und eine vereinfachte Version des Pokerspiels. Im November 1939 gab er als mögliches Vorlesungsthema in der Rolle als VisitingProfessor an der Universität Washington für das kommende Sommer semester die Spieltheorie an. Er erwähnte ausserdem unveröffentlichtes Material zum Pokerspiel zu haben [21], [62]. Schon bevor OM in sein Leben getreten war, war JvN bewusst, dass sein MinimaxTheorem für die ökonomische Theorie von Belang war.
OM zeigt schon Anfang der 30er Jahre eine offene häretische Haltung gegenüber der österreichischen ökonomischen Schule und seinem Gründer Carl Menger (der Vater von Karl Menger) : “Although Menger did not employ mathe matical symbols he is listed by Irving Fisher in his bibliography of mathematical economics and quite properly so, for Menger resorts to mathematical methods of reasoning. This is true also of many later representatives of the Austrian school.” [63]. Er lehnte Einwände gegen den Gebrauch der Mathematik in der Ökonomie ab, die “end to identify mathematics with infinitesimal calculus and overlook the existence of such branches of mathematics as are adapted to dealing with qualities and discrete quantities; moreover mathematics is no more to be identified with the ‘mechanical’ than ordinary logic.” [63]. OM antizipierte bereits 1931 die Anwendung der diskreten Mathematik auf die Ökonomie. So ist es nicht verwunderlich, dass OM in den 30er Jahren nicht nur am mathematischen Kolloquium von Karl Menger teilnahm, sondern seine mathematische Weiterbildung in die Hände von Abraham Wald als Tutor legte.
Wie der mengentheoretische Elephant in die ToG kam
Das berühmt gewordene Beispiel von Sherlock Holmes und seinem Gegenspieler Professor Moriarty interpretiert OM als Strategieproblem [16] und erweitert im Rahmen der Analyse von Vorhersagen und ihrer selbstbezüglichen Wirkung die Lösungmethodik derartiger Fragestellungen [27]. Er zeigt, dass die Annahme von perfekten Vorhersagen zu Paradoxien führt und so für eine allgemeine Gleichgewichtstheorie nicht getroffen werden darf.
Diese Publikation von 1935 veranlasste nicht nur Moritz Schlick, den Kopf des “Wiener Kreises“ (in dem so berühmte Männer wie Carnap, Gödel, Hahn, Popper , Menger , Waismann uvm., Mitglieder waren), OM ein zuladen, um darüber zu referieren, sondern auch K. Menger , ihn für einen entsprechenden Vortrag im “Wiener Kolloquium“ zu gewinnen. Dort wurde OM von dem Mathematiker Eduard Cech erstmals auf JvN’s Arbeit [25] hingewiesen, in der dieser ganz ähnlichen Fragen nachgegangen war. Leider war es OM selbst in der Folgezeit aufgrund überbordender Arbeit unmöglich, JvNs Papier näher zu studieren [29]. Dem nicht genug, weilte OM im Jahr 1937 exakt zu dem Zeitpunkt in Griechenland, als JvN zu Gast in Mengers Kolloquium war und seine Theorie der expandierenden Ökonomie vorstellte. Dort zitierte JvN aus seiner Arbeit [25] und bemerkte, dass “The question whether our problem has a solution is oddly connected with that of a problem occurring in the Theory of Games dealt with elsewhere.“ [64]. Als umgekehrt im Januar 1938 OM auf Einladung vom “Carnegie Endowment for international Peace“ auf Vortragsreise in den USA war, nutzte er sogleich die Gelegenheit um das IAS in Princeton zu besuchen. Wiederum verfehlten sich die beiden.
Als im März 1938 die Naziherrschaft Wien erreichte, musste OM unverzüglich sein Institut verlassen und folgte dem Ruf nach Princeton, USA. Andere Angebote amerikanischer Universitäten schlug er aus, denn ein nicht un bedeutendes Motiv war für ihn die Aussicht, endlich JvN begegnen zu können. Zum Teil gesponsert von der Rocke
feller Foundation trat OM sein auf drei Jahre befristetetes Amt als ”Class of 1913“Professor in politischer Ökonomie an.
Anekdotisch erzählt OM in seinem Rückblick von 1972 davon, dass sich weder er noch JvN an ihre allererste Begegnung zu erinnern vermochte [29]. Entscheidend war ihr zweites Aufeinandertreffen am 1. Februar 1939 im Nassau Club, Princeton : OM sprach dort nach dem Mittagessen in einer lockeren Runde u.a. vor JvN und Niels Bohr über seine Theorie der Wirtschaftszyklen. (Nicht zuletzt findet N.Bohrs Erkenntniss vom Beobachter der die Beo bachtung beeinflusst ihre Entsprechung in OMs Betrachtung der sich selbst erfüllenden Prädiktion). Prompt wurde OM noch am selben Tag in die Fine Hall eingeladen, wo sie zu dritt die Thematik vertieften. Dies war der Auslöser für einen größer werdenden Diskussionszirkel zur Spieltheorie und verwandten Gebieten, der privat bei JvN, aber auch gelegentlich bei Hermann Weyl tagte. Sogar Albert Einstein war zu Gast in dieser Runde. OM hatte nun den Anlass, intensiv die mathematisch anspruchsvollen Arbeiten [25] und [65] von JvN zu studieren, die ihm Jahre vorher E. Cech empfohlen hatte. (Im Kontext eines eigenen Modells adaptiert JvN in [65] die Ungleichungen von Schlesinger und Wald 4 , transformiert in Erweiterung die PreisKosten Gleichungen in Ungleichungen, um so genannte “nichtproduzierte” Güter berücksichtigen zu können.) Dieses Potential für die ökonomische Theorie im Bewusstsein, entwarf OM im Laufe des Jahres 1940 ein Manuskript, um die Bedeutung der Spieltheorie seinen Fachkollegen aufzeigen zu können. OM diskutierte rege mit JvN während der Entstehungsphase das Manuskript, und wurde von ihm ein ums andere Mal dazu angeregt, den mathematischen Teil so zu erweitern, dass es auch für Nicht spezialisten verständlich wäre. Und so kam es, dass JvN eines Tages im Herbst 1940 OM die schon beinahe un vermeidliche Frage stellte : “Why don’t we write this paper together?“ [29]. Aus dem anfänglich geplanten Artikel sollte erst ein Beitrag für die “Annals of Mathematic Studies” werden, doch bald erkannte JvN den Umfang ihres Projekts und schlug die Princeton University Press als Herausgeber ihrer Arbeit vor. Schnell kam es zu einer Einigung über die Drucklegung eines Werks, das in etwa 100 Seiten umfassen sollte. Über einen Abgabetermin wurde nicht verhandelt. Weihnachten 1940, nach einem Vortragsaufenthalt von OM in New Orleans, machten beide Ferien Biloxi. JvNs Frau Klara war ebenfalls dabei. OM diskutierte mit JvN intensiv das Problem, dass das Konzept des zu erwartenden Nutzens als numerische Größe in ihrer Theorie noch nicht schlüssig verankert war. Erst die Überarbeitung der axiomatischen Basis ermöglichte es ihnen die Existenz dieser Größe zu beweisen, und zu zeigen, dass sie bis auf eine lineare Transformationen bestimmt werden kann. Dieser Existenzbeweis fehlt noch in der ersten Ausgabe der ToG von 1944, obwohl die Autoren ihn natürlich formuliert hatten.
Es war für beide selbstverständlich von großer Bedeutung festzustellen, wie es um die Rezeption der neuen Spiel theorie seitens ihrer Kollegen aus der Ökonomie stand. JvN stellte dazu im Rahmen des allgemeinen ökonomischen Seminars in der Pyne Library seine Arbeit [65] aus dem Jahr 1937 vor. Obwohl das Seminar gut besucht war, kam es enttäuschenderweise zu keinerlei Reaktion aus der Zuhörerschaft. Die Ursache ist schnell ausgemacht : es gab zu dieser Zeit kaum mathematisch versierte Ökonomen in Princeton [29].

Die Pyne Library in Princeton, heute East Pyne. Die Pyne Library wurde erbaut in Form eines 216×155 Fuß grossen Rechtecks. Der Innenhof umfasst ungefähr 74 Quadratfuß. Ihn ereicht man geradewegs durch ein Bogentor über den Hauptfußweg der hinter der Nassau Hall verläuft. In den ersten Jahrzehnten lagen holzgetäfelte Seminarräume auf jedem der 4 Stockwerke an den Gebäudeecken, während endlose Buchregale die Verbindungsgänge säumten. Um viel natürliches Licht im Inneren zu haben wurden die Regale mit gläsernen Fachböden versehen. 1897 wurde die der Pyne Library eröffnet und hielt ihre Funktion bei bis zur Errichtung der Firestone Library im Jahr 1947, von wo an sie als Verwaltungs gebäude genutzt wurde. Seit 1965 dient sie als Studentenzentrum und beherbergt außerdem Fakultätsbüros und Lehrräume.
Nicht anders erging es OM mit seiner Arbeit “Professor Hicks on Value and Capital” [66], die 1941 erschien. Diese bezieht sich nicht nur auf JvNs Theorie der expandierenden Ökonomie, sondern auch auf Arbeiten von Abraham Wald über das WalrasSystem[6768]die im Rahmen des Wiener Kolloquiums von Menger ein paar Jahre vorher entstanden sind [6768]. Während der Kriegsjahre war die Zeit noch nicht reif für die Spieltheorie.
OM und JvN arbeiteten 1941 und 1942 intensiv an der ToG weiter. Wenn auch spärlich besucht, hielt JvN einige Vorlesungen zum 2 bzw. nPersonenspiel ab. Dies half ihnen zumindest, ihre Ideen weiterzuentwickeln und das Manuskript voranzutreiben. Ungezählte Male trafen sich die beiden in der Westcott Road 26, wo JvN mit seiner Frau Klara und ihrer Tochter Marina lebte, um gemeinsam an der ToG zu schreiben und sie zu diskutieren. Klara fühlte sich in der Folge schrecklich vernachlässigt. Weil Klaras Hobby zu der Zeit das Sammeln von Elefantenfigürchen war, entwarfen die beiden ihr zum Trost ein Diagramm in der Gestalt eines Elefanten, das sie in ihr Buch integrierten. So kam der Elefant in die ToG.
Durch Zufall fand OM 1944 beim Stöbern in der Bibliothek des IAS einen elementaren Beweis von dem Borelschüler J . Ville [69] zu JvNs Minimax Theorem in einem Band von E. Borel [61], der auf Konvexitätsbetrachtungen basiert. Diese elegante Vorgehensweise war nicht nur für beide völlig überraschend, sondern ganz allgemein der Beginn der Einführung der Methoden konvexer Körper in die ökonomische Theorie.
Im Jahr 1942 wurde JvN nach Washington gerufen, da er nicht zuletzt kriegsbedingt als Forscher in den Diensten der US Navy stand. Das Manuskript der ToG war glücklicherweise schon weit fortgeschritten. OM pendelte nun an den Wochenenden häufig zwischen Princeton und Washington hin und her, um die Arbeit voranzutreiben. Eher seltener reiste JvN nach Princeton, wie zu den Weihnachtsfeiertagen 1942. Dies waren die lange herbeigesehnten Tage, an denen die allerletzten Seiten des Mammutwerkes Gestalt annahmen. Glücklicherweise hatte OM während der ganzen Zeit gewissenhaft nach jeder Arbeitssitzung den neu entstandenen Text in zweifacher Ausfertigung getippt, mit Formeln versehen, und jeweils ein Exemplar JvN bei nächster Gelegenheit ausgehändigt, so dass die abschließenden Korrekturen relativ schnell zu machen waren. So konnten sie im Januar 1943 das Vorwort verfassen. Ihr Werk hatte enorm an Umfang zugelegt, denn aus der Anfangs geplanten hundertseitigen Abhandlungen sind schließlich 1200 getippte Manuskriptblätter geworden.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie keinerlei finanzielle Unterstützung erhalten. Nicht einmal sogenannte “teaching credits“ rechnete ihnen die Universität an. Davon zu schweigen, dass sie nie eine Sekretärin zur Manuskripterstellung engagiert hatten. Die Princeton Press stellte sich sehr entgegenkommend der drucktechnischen Herausforderung, obwohl der Rahmen der ursprünglichen Abmachungen vollkommen gesprengt worden war. Neben 4000$ an Rocke feller Geldern für die Princeton University Press [19], erhielten sie weitere 500 US$ von der Princeton University, um eine saubere Druckvorlage erstellen zu lassen. Dies erledigte ein junger japanischer Mathematiker. Es sollten aber noch einmal 1 1/2 Jahre mit Nachkorrekturen und dem Setzen der Lettern vergehen, bis das erste Exemplar der ToG am 18ten September 1944 der Öffentlichkeit vorgestellt werden konnte. Jede Befürchtung der Princeton Press, das Buch würde ein finanzielles Desaster werden, wurde schneller zerstreut als gedacht.
Die aktuelle Princeton Press Edition der “Theory of Games and Economic Behavior”

Die Abbildung zeigt die Jubiläumsausgabe zum Anlass des 60sten Erscheinungs jahres der ToG. Folgende prominente Rezensionen zur Rezeption der ToG bringen ihre fundamentale Bedeutungen zum Ausdruck :
“Posterity may regard this book as one of the major scientific achievements of the first half of the twentieth century. This will undoubtedly be the case if the authors have succeeded in establishing a new exact science the science of economics. The foundation which they have laid is extremely promising.” [The Bulletin of the American Mathematical Society].
“One cannot but admire the audacity of vision, the perseverance in details, and the depth of thought displayed in almost every page of the book The
appearance of a book of this calibre is indeed a rare event.” [The American
Economic Review].
“The main achievement of the book lies, more than in its concrete results, in its having introduced into economics the tools of modern logic and in using them with an astounding power of generalization.” [The Journal of Political Economy].
“While the jury is still out on the success or failure of game theory as an attempted palace coup within the economics community, few would deny that interest in the subject as measured in numbers of journal page is at or near an alltime high. For that reason alone, this handsome new edition of von Neumann and Morgenstern’s still controversial classic should be welcomed by the entire research community.” [SIAM News].
Quelle : http://www.pupress.princeton.edu/titles/7802.html
2.3. Die ToG in ihrer Wirkung
Entgegen allen Prognosen war die ToG 1947 ausverkauft. Diesen Umstand verdankte sie vor allem der Tatsache, dass im März 1946 ein gut recherchierter Artikel über die ToG die erste Seite der Sonntagsausgabe der New York Times zierte. Wie kam es dazu? : der Einfluss der ToG konnte kaum direkter Natur sein, da mathematisch versierte Ökonomen bis heute eher die Ausnahme sind. In der Tat waren es zwei feinsinnige Exposees von L. Hurwicz [70] und J . Marschak [71] und vor allem eine ausführliche Darstellung der ToG der Feder von Abraham Wald [72] 5 . Darüberhinaus waren es Schüler von OM bzw. JvN, die durch eine große Zahl von Arbeiten zur ToG Rezensionen eine nicht zu unterschätzenden Vermittlerrolle einnahmen. Hier zeigen sich gewisse Parallelen zur Rezeptions geschichte von Keynes “General Theorie”, mit dem Unterschied, dass dieses Buch schließlich doch von Ökonomen gelesen wurde und wird. Schon 1947 wurde die ToG in zweiter Auflage verkauft. Diese hatte einen erweiterten Appendix, der u.a. auch den auf der Axiomatik der ToG beruhenden Existenzbeweis des numerischen Nutzens enthielt. Die dritte Auflage erschien 1953. Diese war bis auf das Vorwort identisch zur zweiten Auflage. Die Absicht ihrer Autoren war es, zur weiteren Entwicklung der Spieltheorie auf die Verfügbarkeit der Grossrechner zu warten, die JvN zu entwerfen im Begriff war. Dies hätte sie nämlich in den Stand versetzt, profunde rechnergestützte Analysen der vorhandenen ökonomische Zeitreihen durchzuführen. Leider wurden all diese Pläne durch die Krebserkrankung JvNs im Jahr 1955 zunichte gemacht. Bis heute wurde die ToG in viele Sprachen übersetzt und Abertausenden von Abhandlungen dient sie als reiche Quelle.
Das Computing und JvNs Automatentheorie
Heuristisches Computing und JvNs JONIAC
Der heuristische Gebrauch des Computers ist ähnlich mit (und könnte damit kombiniert werden) der traditionellen hypothetischdeduktivexperimentellen Methode. Hier ersetzt nur das Computerergebnis das Experiment. Man stellt eine Hypothese über mögliche Gleichungen auf, berechnet damit bekannte Spezialfälle und vergleicht die Resultate. Die Berechnungen können also u.U. mit experimentellen Daten verglichen werden In diesem Fall spricht man von Simulation.
JvN war der Meinung, dass inadäquatem mathematischen Wissen über die nichtlinearen partiellen Differential gleichungen durch praktischen Einsatz des Computers zu begegnen wäre. Es war nämlich seine Überzeugung, dass die reine Mathematik ganz besonders von den Fragestellungen und Ideen der empirischen Wissenschaften profitieren würde. Natürlich war ihm bewusst, dass die Mathematik keine empirische Wissenschaft ist, und dass die Auswahl kriterien mathematische Probleme in der Hauptsache ästhetischer Natur sind. Er schreibt in [73] : “… i think that it is a relatively good approximation to truth… that mathematical ideas originate from empiries… and is better compared to a creative one, governed by almost entirely aesthetical motivations… ”
Bemerkenswert ist, dass in JvNs heuristischem Ansatz der Mensch und nicht die Maschine die Quelle der Kreativität ist. So intelligent er den Rechner auch machen wollte, erkannte JvN doch die Überlegenheit menschlicher Intuition und Vorstellungskraft über die Fähigkeiten des Rechners an. Um eine kreative Zusammenarbeit zwischen Mensch und Computer zu ermöglichen, waren neue Methoden und neue Schnittstellen vonnöten. Viele davon hat er selbst ent wickelt. Zum einen lieferte er wichtige Beiträge zur numerischen Integration, Matrizeninversion, Stabilität uvm., und zum anderen beschäftigte er sich allgemein mit den Fragen der Programmierung von Computern und ihrem logischen Design. Der erste Hochgeschwindigkeitsrechner war ENIAC , konstruiert im Zeitraum von 1943 bis 1946 u.a. von A. Burks, J . Mauchley und J .P. Eckert an der Moore School of Electrical Engineering (University auf Pennsylvania), von dem JvN im Sommer 1944 erfahren hatte. Auch wenn er das Design von ENIAC nicht mehr beeinflussen konnte, machte er kurz nach dessen Fertigstellung Vorschläge zur Modifikation, um die Programmierung der Maschine wesentlich zu vereinfachen. ENIAC war verschieden von seinen Vorgängern und ebenso völlig anders als all seine Nachfolger [6]. Der Unterschied lag zum Beispiel im Gebrauch halbautonomer CUs (Computing Units), die simultan arbeiteten, und im ausschliesslichen Einsatz von Vakuumröhren.
Der Mathematiker Nicholas Metropolis (rekrutiert für das Los Alamos National Laboratory von R. Oppenheimer im April 1943), der später das Computerprojekt leiten sollte, schrieb [45]: „In early 1945, as the construction of the ENIAC was nearing completion, von Neumann raised the question … of using it to perform the very complex calcu lations involved in hydrogen bomb design. The response was immediate and enthusiastic. Arrangements were made by von Neumann on the basis that the ‘Los Alamos problem’ would provide a much more severe challenge to the ENIAC on its shakedown trial.“ N. Metropolis wurde kurz darauf von der US Armee eingeladen, die Fähigkeiten des dreißig Tonnen schweren Rechners zu testen. Die ersten Kalkulationen, die der in der Presse als “Giant Brain“ bezeichnete ENIAC im Dezember 1945 ausführte, waren Berechnungen für die SuperBombe in Los Alamos. Es war der Beginn des Zusammenwachsens der nuklearen Waffenforschung mit der Entwicklung der Computertechnik. S. Ulam, den JvN für Los Alamos gewonnen hatte, sagte [4]: “The magnitude of the problem was staggering. In addition to all the problems of fission … neutronics, thermodynamics, hydrodynamics, new ones appeared vitally in the thermonuclear problems: the behavior of more materials, the question of time scales and interplay of all the geometrical and physical factors … It was apparent that numerical work had to be undertaken on a vast scale“ [74].
Enrico Fermi hatte bei einer Zusammenkunft mit Edward Teller bereits 1941 in New York die eben zitierte Problematik angesprochen. Die Theorie der “SuperBombe“, die er wenig später gemeinsam mit E.Teller entworfen hatte, beinhaltete ein nahezu unlösbares mathematisches Problem. Es fehlte eine leistungsfähige Rechentechnik, um zu zeigen, daß sich die Bombe zünden würde. Die Machbarkeit der SuperBombe (siehe 1.5) mußte also mathematisch bewiesen werden. JvN begriff sofort, welche Möglichkeiten ein Rechner wie ENIAC für die komplexen Berechnungen in Los Alamos bot. Die Maschine war von der Armee für ballistische Kalkulationen in Auftrag gegeben worden. Bereits ab Dezember 1945 wurde der ENIAC für die komplexen mathematischen Probleme genutzt. Etwa eine halbe Million Lochkarten mit Kalkulationsdaten wurden erstellt. S. Ulam schreibt in [45]: “The results of the calculations had great importance in leaving open the hopes for a successful solution to the problem and the eventual construction of an H-Bomb. One could hardly exaggerate the psychological importance of this work and the influence of these results […] on people in the Los Alamos laboratory in general. This [was] partly because of the existence of comput ing machines which could perform much more detailed analysis and modeling of physical problems.“ Aufgrund JvNs Einsatz für die verstärkte Nutzung von Computertechnik wurde die Lösung der benötigten Differentialgleichungen erheblich beschleunigt. Gleichzeitig trug sein Engagement dazu bei, daß die Wissenschaftler in einem kritischen Stadium des Projekts zur Weiterarbeit motiviert wurden. Die Berechnungen zur Machbarkeit der thermonuklearen Bombe waren für ENIAC mit seinem Speicher von 1.000 Bit und seinen 17.468 Röhren zu kompliziert. Auch eine stark vereinfachte Kalkulation brachte zunächst keinen eindeutigen Nachweis, daß der Bau der Bombe möglich sein würde. Dennoch blieb der 1946 nach Aberdeen Proving Ground überbrachte Rechner acht Jahre im Dienst der Wissen schaftler von Los Alamos. Es gab 1946 neben ENIAC keine weitere Maschine, auf welche die Wissenschaftler in Los Alamos zurückgreifen konnten.

ENIAC ,1946
(Electronic Numerical Integrator Analyzer and Computer)ENIAC wurde programmiert, indem die mechanischen Schalter der PCs (Program Controls) betätigt, die verwendeten PCs allesamt verkabelt und die Funktionstafeln entsprechend geschaltet worden waren. Diese Prozedur war langwierig, mühsam und fehleranfällig. Während dieser Programmierung stand die Maschine still. JvN zeigte (Appendix A, 1981, First Draft of a Report on the EDVAC) wie man ENIAC in einen zentral programmierbaren Computer umbauen, und die komplette Programmierung auf die Schaltung der Funktions tafeln reduzieren konnte. H.H. Goldstein engagierte JvN als Berater und sie begannen mit dem Entwurf des sogenannten EDVAC. 1946 war das Design für den EDVAC fertig. Aber Mauchly und Eckert verliessen das Projekt. So dauerte es bis 1952 als ENIAC an der Moore School in Betrieb ging. Währendessen verbesserte JvN das Konzept des ENIAC weiter und baute bis 1952 am IAS eine eigene Version : den JONIAC (nicht zu verwechslen mit dem JOHNNIAC von Willis Ware, Rand Corporation, aus dem Jahr 1953).
Quelle : http://edu.meso.net
Eine Welle von Nachbauten kam an den amerikanischen Universitäten in Gang. Die “Von Neumann Architektur“ begann ihren Siegeszug als Prototyp für den modernen Computer. In diesem Zusammenhang darf der Name des deutschen Ingenieurs Konrad Zuse nicht fehlen. Zuse stellte am 5. Dezember 1945 bereits den Z3 fertig, die erste elektromechanische Mehrzweckmaschine, die programmiert werden konnte. Zuse wollte anhand des Z3 demonstrieren, dass es möglich ist, zuverlässige, programmierbare Rechner für schwierige arithmetische Aufgaben zu konstruieren. Die Rechnungen wurden mittels binären Floating Point Operationen ausgeführt. Die wesentlichen Ideen der “VonNeumannArchitektur” wurden bereits 1936 von Konrad Zuse ausgearbeitet, in zwei Patentschriften von 1937 dokumentiert, und größtenteils schon 1938 im Z1 realisiert. Zuse erkannte aber JvNs Verdienste um die Mathe matisierung und Verwissenschaftlichung der Rechenmaschinen und dessen Urheberschaft des seriellen Konstruktions prinzips an.
Die Theorie der selbstreproduzierenden Automaten
Aus den im Dezember 1949 zur Automatentheorie gehaltenen Vorlesungen an der University of Illinois sind ein Typoskript und eine Bandaufnahme hervorgegangen. Beide sind schlecht erhalten, voller Lücken und unverständlicher Passagen. JvN hat das Typoskript selbst niemals editiert, sondern wollte später für das Buch das Manuskript “The Theory of Automata : Construction, Reproduction, Homogeneity” aus dem Jahr 1952 verwenden (siehe Einführung 3.2 oben). Die Bandaufnahme wurde von A. Burks umfangreich bearbeitet und bildet den ersten Teil des Buches [30]. JvN machte eine detaillierte Skizze für die Illinois Vorlesungen. Sie trug den Titel “Theory and Organisation of Complicated Automata” und begann mit folgenden Zeilen [30] : “The logical organisation and limititations of highspeed digital computers. Comparision of these and other complicated automata, both artificial and natural. Inference from the comparision of the nervous system found in nature.”
Das zweite Manuskript (siehe Nummer 4, Einführung 3.1) ist in deutlich besserer Verfassung. Es ist zwar nur ein Entwurf, besitzt aber bereits etliche Grafiken und ist prinzipiell publizierbar. Leider sind die Figuren nicht betitelt, Abschnitte und Figuren identisch numeriert, wobei nie genau spezifiziert wird welches Element mit bei einer Nummernangabe gemeint ist. Die Titel der Abschnitte finden sich auf einem separaten Bogen, die Fußnoten sind nur skizziert. Natürlich befinden sich im Text nicht unerhebliche Fehler, die sich Verlauf “addieren“ und verstärken. Am Ende bricht das Manuskript bei der Konstruktion des Bandlaufwerks ab. A.Burks vervollständigt hier das Design des selbstreproduzierenden Automaten. Nach seinen Worten wäre es einfacher gewesen den Text neu aufzubauen, aber er hatte die Absicht dem Leser die Möglichkeit zu geben “to observe a powerful mind at work” [30]. Insofern hat A. Burks Kommentare und Korrekturen sparsam eingesetzt. Unterstützt wurde er von Klara von Neumann (zu der Zeit bereits Klara von NeumannEckardt) und einigen ehemaligen Kollegen von JvN : Stan Ulam, Julien Bigelow, Claude Shannon uvm.
Die tragische Geschichte um “ The Computer and the Brain”
Das Buch “The Computer and the Brain” entstand aus dem Manuskript für die Silliman Lectures, die JvN im Früh jahr 1956 an der Yale University zu halten eingeladen war. Er fühlte sich zutiefst geehrt und betrachtete es als Aus zeichnung, auch wenn er sich als Zeitrahmen gerade einmal eine Woche ausbedingte [32]6 .Der Grund für die Halbierung der üblichen Vortragszeit war, dass JvN seit dem 15.3.1955 mit der Ernennung durch Präsident Eisen
hower zu einem von fünf Commissionern des AEC von Mai an seinen Wohnsitz in Washington hatte. Diese Aufgabe erlaubte es ihm nicht lange abwesend zu sein. Doch seiner Leidenschaft für die Automatentheorie gehorchend, nahm er diese Bürde gerne auf sich. Er beugte sich auch nicht seiner Krebserkrankung, die ihn ab Mitte 1955 plagte. Ganz im Gegenteil : in diesen Tagen der Angst und Unsicherheit ob seiner Genesung arbeitete er fieberhaft an seinen vielen Aufgaben weiter. Tagsüber sass er im seinem Büro der AEC und nachts schrieb er systematisch am Manuskript für die Silliman Lectures [32]. Ab November 1955 wurde leider alles noch schlimmer : man fand zahlreiche maligne Läsionen in seinem Rückgrat, was ihn ab Januar 1956 an den Rollstuhl fesselte. So gut es ging, kam er trotzdem seinen zahlreichen Verpflichtungen nach. Dennoch musste er viele Termine von einem Tag auf den anderen absagen oder verschieben, da sein Gesundheitszustand starken Schwankungen unterworfen war. Ab März 1956 war allen klar, dass er unfähig wäre die Vorträge selbst zu halten. Bis dahin hatte er am Manuskript gearbeitet. Man entschied die Vorträge stattfinden zu lassen unter Zuhilfenahme eines Ersatzredners, der seinen Text benutzen sollte. Anfang April 1956 wurde JvN in das Walter Reed Hospital eingeliefert. Dort versuchte er vergeblich das Skript zum Vortragstermin fertigzustellen. Die Krankheit hatte endgültig die Oberhand über seinen außergewöhnlichen Geist gewonnen. Tragischerweise konnte er den Text niemals zu Ende bringen. Während der letzten leidensvollen Monate seines Lebens konnte er das Hospital nicht mehr verlassen.
“The Computer and the Brain” aus dem Jahr 2000

Die Abbildung zeigt das Cover der zweiten Auflage von “The Computer and the Brain” der Yale University Press vom 11ten Juli, 2000. Das Buch geht zurück auf JvNs “Mrs. Hepsa Ely Silliman Memorial Lectures”.
Diese Ausgabe enthält ein Vorwort von Paul M. Churchland und Patricia S. Churchland, zwei bedeutenden Philosophen auf dem Gebiet der Neurowissen schaften und der Bewusstseinsforschung.
JvN betrachtet hier die Analogien zwischen Rechnern und dem menschlichen Gehirn. Er schließt, dass das Gehirn teilweise digital, teilweise analog arbeitet. Allerdings benutzt seiner Meinung nach das Gehirn eine spezielle statistische Sprache im Gegensatz zum Computer.
Quelle : http://yalepress.yale.edu
“The Computer and the Brain” im Abriss
Der Computer
In analogen Maschinen liegen Zahlen als reale physikalische Größen, die in Einheiten unterteilt sind, vor. Computer komponenten operieren damit in Form mathematischer Basisoperationen. Die konventionellen Basisoperationen sind
+, , * und / . Bisweilen werden die 4 direkten Basisoperationen mithilfe der Komponenten “differential gear” und “integrator” auf 3 Operationen reduziert
(Kombinationen dieser Operationen liefern die Division). Dies ist von Vorteil bei der Behandlung total differenzierbarer Gleichungssysteme. Ein dezimaler digitaler Rechner benötigt mindestens vier binäre “Marker“ (24^10 ) um eine Zahl zu repräsentieren. Die Kommastelle ist dabei adjustierbar. Ein Marker ist eine vordefinierte elektrische Verbindung die einem Kontrollorgan unterliegt. Die jeweilige Kombination von elektromagnetischen Relais, Vakuum röhren, ferromagnetischen Kernen und Transistoren definiert den Rechnertyp. Die (10) elektrischen Impulse einer Zahl können je nach Bauart parallel oder seriell (dh in zeitlicher Abfolge) transportiert werden. Bei einer digitalen Operation wie z.B + oder darf natürlich nicht das Übertragsbit vernachlässigt werden. Also wird die binäre Addition stabelle auf drei Therme erweitert : z.B gilt 1+1+1=11 usw.
In analogen Maschinen müssen a priori genügend Komponenten (physikalisch!) vorhanden sein, um die benötigten Basisoperationen ausführen zu können. Ein “Setup” der Maschine ist nötig, und bleibt fix während der ganzen Kalkulationen (“plugged control”). Somit besteht eine Abhängigkeit der analogen Rechner-architektur von der Problem stellung. Beim digitalen Rechner gilt das EinKomponentenPrinzip : eine bestimmte Komponente ist zuständig für eine bestimmte Operation. Daraus folgt die Notwendigkeit eines größeren Speichers (“Memory”). Der Speicher ist die Gesamtheit der Speicherregister, und deren Anzahl bestimmt die Kapazität des Speichers.
Die Kontrollorgane des Rechners heißen CSP (“Control Sequence Point”). Ein CSP ist zum Beispiel mit einer für eine Basisoperation zuständigen Komponente verbunden und zugleich mit dem entsprechenden Speicherregister. Nach Durchführung und Speicherung der Operation setzt das CSP den ihm nachgeschalteten CSP in Gang. Die Kombination der CSPs kann konditionell (oder auch rekursiv) sein, da ein CSP mehrere Zustände einnehmen kann,
was wiederum entsprechend viele Speicherregister erfordert. Alternativ zu den CSPs kann die Kontrolle direkt von speziellen Speicherregistern übernommen werden (“Memory stored Control”). Hierbei werden “Orders”, also Adress kombinationen von den an einer Operation beteiligten Speicherregistern (Input und Outputregistern) gebildet. Den Operationen selbst wird ebenfalls eine Adresse zugeteilt. Anhand einer entsprechenden Adressierungslogik lässt sich das Nachfolgekontrollregister adressieren (konditionelle Muster sind ohne weiteres realisierbar). Die Gesamtstruktur aller gespeicherten Orders ist somit ein Abbild der Aufgabenstellung an den Rechner. Da diese Speicherkontroll struktur dynamisch angepasst werden kann, ist ein effizientes Computing möglich.
Natürlich ist auch ein gemischtes Kontrollsystem realisierbar. Hier wird das Verbindungenschema einer relais gesteuerten Verbindungsmechanik in aufeinanderfolgenden Registern als digitale Adressequenz abgespeichert. Je nach Ausführung der Maschine beeinflussen nun Änderungen in den Speicherregistern wiederum (partiell) das Schaltungsschema usw. Damit sind halbanalog, halbdigitale Maschinen denkbar mit zusätzlichen Komponenten, die digitale in äquivalente analoge Signale verwandeln. Die Klasse der PDSRechner (“puls density system”) rechnet sowohl analog als auch digital, und stellt Zahlen als Aufeinanderfolgende elektrischer Impulse (mit spezifischer zeitlicher Abfolge) dar.
Die Präzision des PDS liegt bei 10^2 (dh. bei maximal 10^2 Impulsen pro Sekunde). Generell liegt die Präzision mechanischer Rechner bei maximal 10^5 , während Digitalrechner praktisch unbegrenzt exakt sein können in Ab hängigkeit der speichertechnisch erlaubten Zahlenlänge und der erwünschten Rechengeschwindigkeit. Üblicherweise wird hier mit einer Präzision von 10^12 operiert (das ergibt annähernd bei 10^18 Operationen bei einer Zufallsverteilung
des Fehlers eine akkumulierte maximale Genauigkeit von 1/10^12 …. .
Analogrechner bestehen nach JvN aus 100 bis 200 Elementen für Basisoperationen und tausenden von Kontrollorganen. So ist ein Preis von über einer Million Dollar realistisch. Digitalmaschinen bestehen aus bis zu 30000 aktiven Komponenten und bis zu 4000 Speicherelementen (inklusive Input und Outputinstanz). Die Geschwindigkeit beträgt bei einer Relaisarchitektur 10^2 sec (pro elementare Operation), mit Vakuumröhren erreicht man 10^6 sec. Es gibt verschiedene Klassen von Speicherelementen. Die Einteilung erfolgt nach der “Access Time“, d.h. nach dem Durchschnitt der Zeit die die Maschine braucht, um eine Zahl im Register zu löschen und die neue Zahl einzuspeichern, und der Zeit, die bei der Übergabe einer Zahl zwischen Registern verstreicht. Sind diese Zeiten nicht abhängig von der Speicheradresse, so spricht JvN von “Random Access”. Beim Computing wird der Speicher hierarchisch aufgeteilt, bestimmt von der “Access Time”.
Das Gehirn
Betrachtet man nun im Vergleich das Gehirn (bzw das komplette Nervensystem), so lassen sich Ähnlichkeiten bzw. Unähnlichkeiten in der Funktionsweise, in der Kontrollsystematik, der Geschwindigkeit oder in der Dichte der Bauweise feststellen. Ein Neuron generiert stetige Impulse, die elektrisch durch die Axone fliessen (50mV/msec), die aber auch chemischer (durch ionische Veränderung der die Membran umgebenden Flüssigkeit) und mechanischer Natur sind (durch Veränderung der Position der Membranmoleküle). Die Einteilung in chemische und mechanische Impulse ist nach JvN allerdings unscharf. Je nach Lage im Körper nehmen Neuronen Licht, Wärme, Druck, Temperatur usw. als Impuls wahr. Der Impuls wird in der Umgebung des Neuronenkörpers erzeugt. Scheitert eine solche Stimulation, so wird diese Störung nicht über die Axone übertragen, sondern stirbt vor Ort ab. Logisch inter pretiert JvN den Impuls als 1 Bit an Information an einer fest definierten Stelle, und sieht ihn einem Marker (siehe oben) vergleichbar. Impulse werden durch andere Impulse (konditionell) stimuliert und über die Synapsen als den Verbindungsstellen der Axone weitergegeben. Derartige Reaktions und Aktionsmuster kennzeichnen das Neuron als aktives Organ. Nach einer Stimulation benötigt das Neuron eine gewissen Ruhezeit, um danach wieder aufnahme bereit zu sein (die Zeitspanne hierbei umfasst ca. 0.015 sec). Diese Ruhezeit verkürzt sich nur dann, wenn ein außergewöhnlich starker Stimulus auftritt.
Beim Größenvergleich des logischen, aktiven Teils der Nervenzelle (der Membrandicke von 10^5 cm) mit dem Äquivalent in der Kathodenröhre bzw. im Transistor (des GitterKathodenabstands bzw. dem Elektrodenabstand von jeweils 10^2 cm) kommt JvN auf ein Verhältnis von 10^3 zu Gunsten des Neurons. Er vergleicht weiter die Volumen dichte (Packungsdichte, Kapazität) beim Neuron (10^7 Neuronen/cm3 ) mit der Transistordichte von maximal 10^2 / cm3 beim Elektronengehirn, und folgert, dass das biologische Gehirn das Elektronengehirn sogar um einen Faktor von 10^8 übertrifft. Ein weiteres Maß bezieht er aus dem Energieverbrauch . Während ein Neuron gerade mal 10^9 W verbraucht, schlagen beim Transistor schon 10^1 W zu Buche. Auch hier konstatiert JvN einen klaren Vorteil für das biologische Gehirn. Natürlich steht außer Frage, dass das Gehirn in Sachen Schnelligkeit dem Rechner
hoffnungslos unterlegen ist. Aber zur Kompensation funktioniert das Gehirn in der Hauptsache simultan (parallel) im Gegensatz zum Rechner, der in der Regel seriell arbeitet. Dabei können serielle und parallele Prozesse nicht einfach einander ersetzen, sondern erfordern ein jeweils angepasstes logisches Schema und eine alternative Speicherbelegung. Daraus folgert JvN einen größeren Unterschied im logischen Ablauf und in der inneren Struktur zwischen natür lichen und künstlichen Automaten. Das Neuron als aktives Organ scheint auf einer logisch höheren Ebene zu agieren, d.h. weitaus komplexere Muster als simple logische Basisoperationen (“AND”,”OR”,”NO”) zu verarbeiten. Man denke dabei an zeitlich versetzte Impulsmuster inklusive der räumliche Anordnung der stimulierten Axone usw. Außerdem haben Neuronen verschiedene Eigenzustände, die die Rezeption von Impulsmustern unterschiedlich ausfallen lassen. Oder sie reagieren nur auf Impulse einer bestimmten Stärke bzw. benötigen ein Mindestmass an Impulsintensitäts schwankung. Das aber bedeutet, dass im digital organisierten Nervensystem analoge Auslöser ebenfalls eine Rolle spielen. So können Prozesse im Nervensystem ihren Charakter mehrfach alternierend von digital zu analog ändern.
Hypothetisch geht JvN davon aus, dass im Gehirn ein oder mehrere Speicherbereiche vorhanden sein müssen, denn deren Fehlen würde den natürlichen Automaten nicht funktionieren lassen. JvN weist darauf hin, dass die Gene der Chromosomen als digitale Speicherelemente dienen, und spekuliert, dass die chemische Zusammensetzung einiger Bereiche im Körper Informationen beherbergen. Unter “Code” versteht JvN ein System logischer Instruktionen die ein künstlicher Automat ausführen kann, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Codes sind in der Ausführung wieder holbar und resultieren in einem eindeutigen Ergebnis. Codes dürfen “vollständig” sein, d.h. es ist implementiert in welcher Reihenfolge Befehle ausgeführt werden und welche Organe dafür zuständig sind. Im Gegensatz dazu gibt es “Short Codes”, die den Automaten veranlassen sich wie ein anderer zu verhalten, d.h. diesen zu imitieren. Damit können maschinenfremde Codes ausgeführt werden und komplexe Operationen auf anderen Automaten in u.U. simple Basisoperationen auf dem eigenen Computer überführt werden (daher der Name “Short Code“). (Ganz analog drückt das Gehirn in unterschiedlichen Sprachen eine Sache ganz unterschiedlich aus, meint aber immer dasselbe; Anm. d. Verf.).
Ein künstlicher Automat besteht aus einem für die Arithmetik relevanten und einem diesbezüglich nichtrelevanten Teil. JvN postuliert dasselbe für den natürlichen Automaten. Künstliche Automaten benötigen wegen der Akkumulation der einzelnen Rechenfehler eine weitaus höhere Präzision in den einzelnen Rechenschritten, als es das Ergebnis am Ende erfordert. Der Präzisionslevel des neuen Neurons ist denkbar gering. Ein Neuron antwortet auf einen Stimulus nach einer Refraktionszeit mit einer Abfolge von Impulsen (50200 Impulse pro Sekunde). Die Antwort frequenz ist eine monotone Funktion der Stimulusintensität (Frequenzmodulation). Daraus resultiert eine hohe Stabilität der Information. Denn selbst wenn einzelne Impulse fehlen, bleibt die Frequenzinformation erhalten. Somit ist das Informationssystem der Nervenzellen eher statistischer Natur, denn präzise digital von “Makern” gesteuert. Im Nervensystem findet also weniger arithmetische Präzision als logische Tiefe statt. Obwohl die Information auf Frequen zmustern als statistischen Objekten beruht, wird die Information von der geringen Präzision nicht verwässert, sondern bleibt exakt. Es ist eine offene Frage für JvN, welche statistischen Eigenschaften (zum Beispiel Korrelationen in den Impulsmustern) genau für den Transport von Informationen in Frage kommen, oder ob sogar die Aufteilung der Einzelimpulse auf die einzelnen Fibern des Axons einen eigenen Informationsgehalt besitzt. Das Nervensystem kommuniziert nach JvN in der Hauptsache rein logisch (inklusive der “Orders” also der Kontrollmechanismen), aber auch arithmetisch, wenngleich bei geringer Präzision. Die Sprache hinter der Logik des Gehirns ist unbekannt. Mathematisches Denken ist sekundärer Natur und basiert auf der imminenten Basissprache des Gehirns.
JvN und die Physik
JvNs Beitrag zur Quantentheorie
Um die Bedeutung von JvNs Arbeit zu begreifen, wollen wir zuerst eine kurze Geschichte der Quantenmechanik präsentieren, damit sein Beitrag im Kontext eine entsprechende Bewertung erfahren kann. Die Entdeckung der Quantisierbarkeit der Energie geht in den Jahre zwischen 1900 und 1930 vor sich, und ist in der Geschichte der Naturwissenschaft ohne Vergleich was die Evolution und Revolution der Ansichten über die Natur von Materie und Energie anbelangt. Am Ende dieses Prozesses stand die Quantenmechanik in der Form wie wir durch sie heute die physikalische Welt deuten und verstehen. Der Ursprung der Quantentheorie liegt in M. Plancks Versuch, die Energie transmission einer simplen Glühbirne zu verstehen, was einen Spezialfall des Strahlungsproblems des schwarzen Körpers darstellt. M. Planck wollte weiter die Verteilung der Strahlungsenergie bei verschiedenen Wellenlängen des Lichts untersuchen. Vgl dazu [75] und [76].
Es war im Jahr 1900 als M. Planck herausfand, dass die korrekte Formel für die Spektralverteilung der Energie unter der empirischen Annahme (ohne dafür eine Rechtfertigung aus der klassischen Strahlungsphysik zu haben) der (später so benannten) Plankschen Wirkungskonstante h (h = 2 fi = 6.6 10 34 Ws2 ) formuliert werden kann. Danach ist die Energie E einer Welle der Frequenz gleich dem Produkt h . Dies stellt die sogenannte Quantenhypothese dar: die Energie eines harmonischen Oszillators ist quantisiert, d.h. ein (diskretes) Vielfaches des Wirkungsquantums. Als klassisches Experiment bekannt geworden ist die Untersuchung des photoelektrischen Effekts, bei dem Licht Elektronen aus einer Metalloberfläche herausschlägt. Hierbei zeigt sich, dass die Energie der emittierten Elektronen nicht von der Intensität, sondern ausschließlich von der Frequenz des eintreffenden Lichts abhängt. Dies ist ein Widerspruch zur klassischen Physik [77]. Die Bedeutung von Plancks Entdeckung trat erst im Zusammenhang mit Einsteins Analyse eben dieses photoelektrischen Effekts fünf Jahre später offen zutage. Einstein folgerte daraus, dass sich Licht so verhält, als bestünde es aus vereinzelten Partikeln. Diese Lichtpartikel wurden später (von dem amerikanischen Chemiker G. N. Lewis) Photonen genannt. Die Energie eines Photons ist nach Einstein E=h . Dies ist exakt die Plancksche Energiegleichung. Die diskrete Natur (oder Quantisierung) der Energie zeigt sich ebenfalls in der Spektroskopie, wo die Strahlungsenergie der Teilchen eindeutige diskrete Werte annimmt. Konfrontiert mit dem Problem der Quantisierung war es nun die Aufgabe der Physiker, Gesetzmässigkeiten zu finden, die eine solche diskrete Verteilung der Energie beschreiben würden. Einsteins Entdeckung, dass sich Lichtwellen wie Teilchen verhalten, war revolutionär. Im Umkehrschluss behauptete L. de Broglie, dass Materie, die üblicherweise als Menge von Teilchen angesehen wird, sich wie eine Welle verhalten kann. N. Bohr postulierte, dass die in spektroskopischen Versuchen beobachteten Energiewerte der Elektronen, die sich selbst wie stehende, den Atomkern umlaufende, Wellen präsentieren, diskret verteilt sind und jeder Umlaufbahn eindeutig zugeordnet werden können. Weiter ist nach
N. Bohr die emittierte Energie eines Elektrons, das den Orbit wechselt, gleich der Differenz der beiden orbitalen Energien [75], [76]
Die endgültige Formulierung der Quantenmechanik im Jahr 1925 beruht auf der Entdeckung Werner Heisenbergs, dass die diskreten Energieniveaus durch Lösen von infiniten Systemen linearer Gleichungen zustande kommen. Äquivalent dazu ist die Betrachtung einer einzigen linearen Gleichung über Matrizen mit unendlicher Dimension. Diese unendlichdimensionalen Matrizen repräsentieren messbare physikalische Grössen wie Positionen oder Momente der Teilchen, die um den Atomkern rotieren. Diese Matrizenmechanik wurde massgeblich von W. Heisenberg, M. Born und P. Jordan entwickelt [75]. Ein unabhängiger Zugang zum Problem der Quantisierung wurde von E. Schrödinger im Jahr 1926 entdeckt. Schrödinger war auf der Suche nach der Wellengleichung (die später als die Schrödingersche Wellengleichung bekannt wurde), die das Wellenverhalten des (de Broglieschen) Teilchens be schreiben sollte [76]. Er fand heraus, dass die quantisierten Energieniveaus genau die Invarianten, d.h. die Eigenwerte seiner Wellengleichung sind. An diesem Punkt der Entwicklung hielt die Wahrscheinlichkeitstheorie Einzug in die Quantenmechanik : M. Born stellte fest, dass Schrödingers Wellengleichung keine physikalische Welle per se be schreibt, sondern Auskunft über die Wahrscheinlichkeitsdichte gibt, ein Teilchen an einer bestimmten Position oder mit einem vorgegebenen Impuls vorzufinden [76], [75]. Es gelang Schrödinger zu zeigen, dass die Matrizenmechanik von Heisenberg äquivalent zu seiner Wellenmechanik ist. Beide Ansätze wurden von P. Dirac in der sogenannten Transformationstheorie vereinigt, wo die Zustände eines physikalischen Systems durch Vektoren in einem abstrakten Verktorraum repräsentiert werden. Operatoren auf diesem Vektorraum repräsentieren messbare physikalische Grössen wie z.B die Position oder das Momentum eines Teilchens. Diese Operatoren “konvertieren” einen Zustand in einen anderen [78], [75], [76].
1927 nun stellte JvN einen streng mathematisch formulierten, axiomatisch aufgebauten Rahmen für die Quanten mechanik vor [11], [79] (Appendix A., 1927). In diesem Jahr verfasste er mehrere Beiträge zur Quantentheorie (Appendix A, 1927). Obwohl die Quantenmechanik längst auch in einer relativistischen Fassung vorliegt, ist JvNs Originalfassung einer nichtrelativistischen, mathematischen Quantenmechanik bis heute sehr populär und wurde in dieser Form die letzten 80 Jahre nicht verändert. In der ersten Publikation von JvN zusammen mit Hilbert und Nordheim [80] machten sie den Versuch, Matrizen und Wellenmechanik in streng formaler Form zu vereinen. Dieser Ansatz wurde später von JvN vervollständigt, indem er eine abstrakte axiomatische Theorie der Hilberträume und ihrer linearen Operatoren vorstellte [79]. Vektoren im Hilbertraum entsprechen den Zuständen eines physikalischen Systems, hermitesche Operatoren auf dem Hilbertraum stellen messbare physikalische Größen dar. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der “vonNeumannDiracschen” Formulierung der Quanten mechanik. JvNs weitere quantenmechanische Forschung widmete sich den statistischen Aspekten dieser Theorie. Wir wollen an dieser Stelle JvNs Postulate in vereinfachter Form zitieren, um seine Leistungen zu den statistischen Aspekten der Quantenmechanik honorieren zu können. Die Grundprinzipien seiner Theorie könnte man folgender maßen formulieren [81], [82] :
Zustand: der Zustand eines physikalischen Systems S wird von einem Element in einem Hilbertraum repräsentiert. Ein Hilbertraum ist ein vollständiger Prähilbertraum. Ein Prähilbertraum ist ein Vektorraum mit einer nicht ausgearteten, positiven, hermiteschen Form.
Observable: jede physikalisch messbare Größe wird repräsentiert durch einen hermiteschen Operator auf dem Hilbertraum. Hermitesche Operatoren können in eine Summe von Projektoren zerlegt werden. Diese Operatoren stellen verschieden starke Expansionen oder Kontraktionen ihrer Eigenvektoren dar, je nach Vorzeichen und Betrag ihrer Eigenwerte.
Bewegungsgesetz: die SchrödingerGleichung ist die Maßgabe für die Entwicklung eines physikalischen (Quanten) Systems entlang der Zeitachse. Die zugehörige Wellenfunktion ist eine Superposition der Eigenzustände ihres Operators.
Messbarkeit: eine Messung ergibt nur die Eigenwerte des Systemoperators. Vor der Messung ist die Wellen funktion eine Superposition der verschiedenen Eigenzustände. Nach der Messung entwickelt sich die Wellenfunktion zu dem Eigenzustand der dem gemessenen Eigenwert entspricht. Das heißt, ein System springt instantan von der anfänglichen Superposition der Eigenzustände zu einem speziellen Eigenzustand über, der dem Eigenwert der zu messenden Größe entspricht.
Mit dieser axiomatischen Grundlage konnte JvN Pionierarbeit im Bereich der statistischen Quantenmechanik leisten [79], [4]. Seine Beiträge sind dabei eher mathematischformaler Natur : JvN führt erstens das Konzept des Dichte operators ein, und formuliert zweitens die quantenphysikalische Formel für die Entropie, die L. Boltzmann für klassische Systeme aufgestellt hatte. Er bestimmt drittens den Operator für das kanonische Ensemble in der statistischen Quantenmechanik, und viertens formuliert sowie beweist er die Ergodentheorie für Quantensysteme. Heutzutage wird JvN, neben der Einführung des Hilbertraumes in die Quantenmechanik, hauptsächlich im Zusammen hang mit seiner profunden Interpretationen der Quantenmechanik in Hinblick auf die Bedeutung der Messung in der Quantenmechanik zitiert.
Was versteht man nun unter dem Messbarkeitsproblem in der Quantenmechanik? Nehmen wir an, dass die Wellenfunktion einen vollständigen Blick auf ein isoliertes System bietet, so unterliegt dieses System vor der Messung der deterministischen Schrödingergleichung, wird aber mit Beginn der Messung einer unstetig verlaufenden, zufalls bestimmten Zustandsänderung unterworfen. Die Interpretation dieser Zufälligkeit wird seit der Entdeckung der Quantenmechanik intensiv diskutiert [83], [84]. Nach der StandardKopenhagener Interpretation ist dieser Zufall nicht das Resultat fehlenden Wissens über das Quantensystem, sondern eine inhärente Eigenschaft der Natur. Diese Zufälligkeit war für Einstein unakzeptabel. Er hielt die Quantentheorie für unvollständig an dieser Stelle, was sein berühmtes Zitat “God does not play dice“ [83], [85], [86] belegt. Eine andere Interpretation dieses Zufalls in der Natur war es, das Vorhandensein versteckter Parameter zu postulieren, die nur entdeckt werden müssten, um die Quantentheorie deterministisch zu machen. Spektakulärerweise beweist JvN in seinem Buch [87], dass die Existenz versteckter Parameter unmöglich ist. Der Beweis baut streng mathematisch auf das Operatorenkalkül der Quanten physik auf. Er löste damit heftige Kontroversen aus, zeigte er doch ganz klar, dass der Zufall Bestandteil der physikalischen Welt ist. Im Laufe der Jahre haben viele Physiker und Philosophen JvNs Entdeckung untersucht [84], [86]. Nur durch die strenge Mathematisierung der Quantenmechanik war es ihm möglich zu dieser Erkenntnis zu kommen. Darin liegt JvNs Verdienst. Im Zusammenhang mit den versteckten Parametern gibt es noch ein anderes Problem : an welchem Punkt des Mess vorgangs kollabiert die Wellenfunktion? JvN war der erste, der das menschliche Bewusstsein als Ursache ansah, d.h. der Übergang der Wellenfunktion würde genau dann statfinden, wenn das Messergebnis das Bewusstsein erreicht. Es war ihm natürlich klar, dass das menschliche Bewusstsein nicht mit den Methoden der theoretischen Physik zu beschreiben ist. Dennoch hat diese Idee ein faszinierendes philosophisches Kapitel am Grenzbereich der Naturwissenschaft aufgeschlagen [85], [86], [82]. S. Ulam (der im Übrigen selbst über Operatoren auf Hilberträumen gearbeitet hat) schreibt in [4] sinngemäss, dass es schwer zu sagen sei, ob JvN neuartige physikalische Ideen formuliert habe, aber unbestritten sei sein Verdienst strenge mathematische Standards in der Physik etabliert zu haben.
Schlusswort
Als herausragender Akademiker seiner Zeit brachte JvN durch seine Erkenntnisse und Ideen die Entwicklung vieler Fachgebiete voran. Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit hatte er bewusst am politischen Geschehen in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts teilgenommen. JvNs enge Zusammenarbeit mit den politischen und militärischen Machthabern mag z.T. in seiner Herkunft begründet sein. Wir haben versucht anhand direkter Quellen eine Skizze dieser Persönlichkeit zu zeichnen. Sekundäre Quellen sollten, wie auch der Fall der gesponserten Arbeit [11] von Macrae zeigt, mit Vorsicht genossen werden. Wenn man sich an das ehrenhafte Verhalten JvNs im Fall Oppenheimer erinnert, so möchten wir auch denjenigen, die ihn zu einem kriegslüsternen, gewissenlosen Karrieristen abstempeln, widersprechen. JvN ist ein grosses Beispiel für einen Wissenschaftler, den die Zeitumstände (und natürlich auch das eigene Engagement) in eine immense gesellschaftliche Verantwortung gebracht haben. Und nicht zuletzt sind wir sehr gespannt darauf, was im Jahr 2007 aus Marina von Neumanns Kiste ans Tageslicht kommt. Was bleibt uns übrig, als mit OM zu schliessen [29]: “There would be so much more to say“.
Appendix A : Bibliographie der Originalarbeiten von JvN
Alle Angaben in eckigen Klammern beziehen auf die Collected Works [Band, Abscnitt].
1922
Über die Lage der Nullstellen gewisser Minimumpolynome.
With M. Fekete. Jahresb. Dtsch. Math. Verein . 31:125138 [I, 2].
1923
Zur Einführung der transfiniten Zahlen. Acta Szeged. 1:199208 [I, 3].
1925
Eine Axiomatisierung der Mengenlehre. J. f. Math. 154:219240 [VoI. I, 4]. Egyenletesen sûrû számsorozatok. (Gleichmässig dichte Zahlenfolgen.)
[Uniformly Dense Number Sequences] Math. Phys. Lapok 32:3240 [I, 5].
1926
Zur Prüferschen Theorie der idealen Zahlen. Acta Szeged. 2 :193227 [I, 6].
Az általános halmazelmélet axiomatikus felépítése. (Doctor’s thesis, Univ. of Budapest.) Cf. 18 .
1927
Über die Grundlagen der Quantenmechanik. With D. Hilbert and L. Nordheim. Math. Ann. 98:130 [I,7]. Zur Theorie der Darstellungen kontinuierlicher Gruppen. Sitzungsber. d. Preuss. Akad. Wiss., 7690 [I,8]. Mathematische Begründung der Quantenmechanik. Gött. Nachr., 157 [I, 9].
Wahrscheinlichkeitstheoretischer Aufbau der Quantenmechanik. Gött. Nachr., 245272 [I, 10]. Thermodynamik quantenmechanischer Gesamtheiten. Gött. Nachr., 273291[I, 11].
Zur Hilbertschen Beweistheorie. Math. Zschr . 26:146 [I, 12].
1928
Allgemeine Eigenwerttheorie symmetrischer Funktionaloperatoren. „Habilitationsschrift”, Univ. of Berlin. Cf. 30. Eigenwertproblem symmetrischer Funktionaloperatoren. Jahresb. Dtsch. Math. Verein. 37: 1114.
Die Zerlegung eines Intervalles in abzählbar viele kongruente Teilmengen. Fund. Math. 11:230238 [I,13]. Ein System algebraisch unabhängiger Zahlen. Math. Ann. 99 :134141 [I, 14].
Über die Definition durch transfinite Induktion und verwandte Fragen der allgemeinen Mengenlehre.
Math. Ann. 99:373391 [I, 15].
Zur Theorie der Gesellschaftsspiele. Math. Ann. 100:295320 [VI, 1]. Sur la théorie des jeux. C. R. Acad. Sci. 186:16891691.
Die Axiomatisierung der Mengenlehre. Math. Zschr . 27 :669752 [I, 16].
Zur Erklärung einiger Eigenschaften der Spektren aus der Quantenmechanik des Drehelektrons, I. With E. Wigner. Zschr. f. Phys . 47:203220 [I, 18].
Einige Bemerkungen zur Diracschen Theorie des Drehelektrons. Zschr. f. Phys. 48:868881 [I, 17] Zur Erklärung einiger Eigenschaften der Spektren aus der Quantenmechanik des Drehelektrons, II.
With E. Wigner. Zschr. f. Phys . 49:7394 [I, 19].
Zur Erklärung einiger Eigenschaften der Spektren aus der Quantenmechanik des Drehelektrons, III. With E. Wigner. Zschr. f. Phys . 51:844858 [I, 20].
1929
Über eine Widerspruchfreiheitsfrage in der axiomatischen Mengenlehre. J. f. Math. 160: 227241[I, 21]. Über die analytischen Eigenschaften von Gruppen linearer Transformationen und ihrer Darstellungen.
Math. Zschr. 30:342 [I, 22].
Über merkwürdige diskrete Eigenwerte. With E. Wigner. Phys. Zschr. 30:465467 [I, 23].
Über das Verhalten von Eigenwerten bei adiabatischen Prozessen. With E. Wigner. Phys. Zschr. 30:467470 [I, 24]. Beweis des Ergodensatzes und des HTheorems in der neuen Mechanik. Zschr. f. Phys. 57:3070 [I, 25].
Zur allgemeinen Theorie des Masses. Fund. Math . 13:73116 [I, 26].
Zusatz zur Arbeit „Zur allgemeinen Theorie des Masses”. Fund. Math . 13:333 [I, 27]. Allgemeine Eigenwerttheorie Hermitescher Funktionaloperatoren. Math. Ann. 102:49131 [II, 1].
Zur Algebra der Funktionaloperatoren und Theorie der normalen Operatoren. Math. Ann. 102:370427 [II, 2]. Zur Theorie der unbeschränkten Matrizen. J. f. Math . 161 :208236 [II, 3].
1930
Über einen Hilfssatz der Variationsrechnung. Abh. Math. Semin. Hamb. 8:2831 [II, 4].
1931
Über Funktionen von Funktionaloperatoren. Ann . Math . 32:191226 [II, 5].
Algebraische Repräsentanten der Funktionen „bis auf eine Menge vom Maße Null”. J. f. Math. 165:109115 [II, 6]. Die Eindeutigkeit der Schrödingerschen Operatoren. Math. Ann. 104:570578 [II, 7].
Bemerkungen zu den Ausführungen von Herrn St. Lesniewski über meine Arbeit „Zur Hilbertschen Beweistheorie”.
Fund. Math. 17:331334 [II, 8].
Die formalistische Grundlegung der Mathematik. Congress report, Königsberg, September 1931.
Erkenntnis 2:116121 [II, 9].
1932
Zum Beweise des Minkowskischen Satzes über Linearformen. Math . Zschr . 30:12 [II, 10]. Über adjungierte Funktionaloperatoren. Ann. Math . 33 :294310 [II, 11].
Proof of the QuasiErgodic Hypothesis. Proc. Nat. Acad. Sci. 18 :7082 [II, 12].
Physical Applications of the Ergodic Hypothesis. Proc. Nat. Acad. Sci. 18:263266 [II, 13].
Dynamical Systems of Continuous Spectra. With B. O. Koopman. Proc. Nat. Acad. Sci. 18:255263 [II,14]. Über einen Satz von Herrn M. H. Stone. Ann. Math. 33:567573 [II, 15].
Einige Sätze über messbare Abbildungen. Ann. Math. 33 :574586 [II, 16].
Zur Operatorenmethode in der klassischen Mechanik. Ann. Math. 33 :587642 [II, 17].
Zusätze zur Arbeit „Zur Operatorenmethode in der klassischen Mechanik”. Ann. Math. 33:789791 [II,I8]. Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik. Springer, Berlin (1932); New York, Dover Publications (1943);
Presses Universitaires de France (1947); Madrid, Instituto de Mathematicas „Jorge Juan” (1949); trans. from German by Robert T. Beyer, Princeton University Press (1955).
1933
Die Einführung analytischer Parameter in topologischen Gruppen. Ann. Math. 34:170190 [II, 19].
A koordinátamérés pontosságának határai az elektron Diracféle elméletében
(Über die Grenzen der Koordinatenmessungsgenauigkeit in der Diracschen Theorie des Elektrons).
[Limits of the Accuracy of Coordinate Measurement in Dirac’s Theory of Electron] Mat. és Természettud. Értesítõ 50 :366385 [II, 20].
1934
On an Algebraic Generalization of the Quantum Mechanical Formalism.
With P. Jordan and E. Wigner. Ann. Math. 35:2964 [II, 21].
Zum Haarschen Maß in topologischen Gruppen. Compos. Math. 1 :106114. [II, 22]. Almost Periodic Functions in a Group, I. Bull. Amer. Math. Soc. 40 : 224.
Almost Periodic Functions in a Group, I. Trans. Amer. Math. Soc. 36 :445492 [II, 23]. The Dirac Equation in Projective Relativity.
With A. H. Taub and O. Veblen. Proc. Nat. Acad. Sci. 20:383388 [II, 24].
1935
On Complete Topological Spaces. Bull. Amer. Math. Soc. 41:35.
On Complete Topological Spaces. Trans. Amer. Math. Soc. 37:120 [II, 25].
Almost Periodic Functions in Groups, II. With S. Bochner. Bull. Amer. Math. Soc. 41:35.
Almost Periodic Functions in Groups, II. With S. Bochner. Trans. Amer. Math. Soc. 37:2150 [II, 26].
On Compact Solutions of OperationalDifferential Equations, I. With S. Bochner. Ann. Math. 36:255291 [IV, 1]. Representations and RayRepresentations in Quantum Mechanics. Bull. Amer. Math. Soc. 41:305.
Charakterisierung des Spektrums eines Integraloperators. Actualités Scient. et Industr.
No. 229; Exposés Math. publiés à la mémoire de J. Herbrand, 13. Paris. 20 pp. [IV, 2].
On Normal Operators. Proc. Nat. Acad. Sci. 21:366369 [IV, 3].
On Inner Products in Linear, Metric Spaces. With P. Jordan. Ann. Math. 36:719723 [IV, 4]. The Determination of Representative Elements in the Residual Classes of a Boolean Algebra.
With M. H. Stone. Fund. Math. 25:353378 [IV, 5].
1936
On a Certain Topology for Rings of Operators. Ann. Math. 37:111115 [III, 1]. On Rings of Operators. With F. J. Murray. Ann. Math. 37:116229 [III, 2].
On an Algebraic Generalization of the Quantum Mechanical Formalism (Part I). Mat. Sborn. 1:415484 [III, 9]. On the Uniqueness of Invariant Lebesgue Measures. Bull. Amer. Math. Soc. 42:343.
The Uniqueness of Haar’s Measure. Mat. Sborn. 1:721734 [IV, 6].
The Logic of Quantum Mechanics. With G. Birkhoff. Ann. Math. 37 :823843 [IV, 7]. Continuous Geometry. Proc. Nat. Acad. Sci. 22:92100 [IV, 8].
Examples of Continuous Geometries. Proc. Nat. Acad. Sci. 22:101108 [IV, 9]. On Regular Rings. Proc. Nat. Acad. Sci. 22:707713 [IV, 10].
Fourier Integrals and Metric Geometry. With I. J. Schoenberg. Bull. Amer. Math. Soc. 42:632. On Rings of Operators, II. With F. J. Murray. Bull. Amer. Math. Soc. 42:808.
1937
On Some Analytic Sets Defined by Transfinite Induction. With K. Kuratowski. Ann. Math. 38:521525 [IV, 19]. On the Transitivity of Perspective Mappings in Complemented Modular Lattices.
With I. Halperin. Bull. Amer. Math. Soc. 43:37.
On Rings of Operators, II. With F. J. Murray. Trans. Amer. Math. Soc. 41:208248 [III, 3].
Some Matrix Inequalities and Metrization of Metric Space. Izv. Tomsk. Gos. Univ. 1:286300 [IV, 20]. Algebraic Theory of Continuous Geometries. Proc. Nat. Acad. Sci. 23 :1622 [IV, 11].
Continuous Rings and Their Arithmetics. Proc. Nat. Acad. Sci. 23 :341349 [IV, 12].
Über ein ökonomisches Gleichungssystem und eine Verallgemeinerung des Brouwerschen Fixpunktsatzes.
Erg. eines Math. Coll. Vienna, ed. by K. Menger, 8:7383.
A Model of General Economic Equilibrium. Translated into English by C. Morgenstern.
Rev. Econ. Studies 13:19 [VI, 3].
1938
On Infinite Direct Products. Compos. Math. 6:177 [III, 6].
1939
Fourier Integrals and Metric Geometry, II. With I. J. Schoenberg. Bull. Amer. Math. Soc. 45:79.
1940
On the Transitivity of Perspective Mappings. With I. Halperin. Ann. Math. 41:8793 [IV, 13]. On Rings of Operators, III. Ann. Math. 41:94161 [III, 4].
Minimally Almost Periodic Groups. With E. Wigner. Ann. Math. 41 :746750 [IV, 21]. With R. H. Kent. The Estimation of the Probable Error from Successive Differences. Report,
Ballistic Research Laboratory, Aberdeen Proving Ground, Md., February 14. 19 pp.
1941
With R. H. Kent, H. R. Bellinson and B. I. Hart. The Mean Square Successive Difference.
Ann. Math. Stat . 12:153162 [IV, 33].
Fourier Integrals and Metric Geometry. With I. J. Schoenberg. Trans. Amer. Math. Soc. 50:226251 [IV, 22]. Distribution of the Ratio of the Mean Square Successive Difference to the Variance.
Ann. Math. Stat. 12:367395 [IV, 34].
Shock Waves Started by an Infinitesimally Short Detonation of Given (Positive and Finite) Energy.
Informal Report to the National Defense Research Committee, Div. B, AM9, June 30.
Optimum Aiming at an Imperfectly Located Target. Appendix to :
Optimum Spacing of Bombs or Shots in the Presence of Systematic Errors,
by L. S. Dederick and R. H. Kent. Ballistic Research Laboratory, Report 24l, July 3. 26 pp. [IV, 37].
Operator Methods in Classical Mechanics, II. With P. R. Halmos. Bull. Amer. Math. Soc. 47:696.
1942
A Further Remark Concerning the Distribution of the Ratio of the Mean Square Successive Difference to the Variance. Math. Stat . 13 :8688 [IV, 35].
Operator Methods in Classical Mechanics, II. With P. R. Halmos. Ann. Math. 43:332350 [IV, 23].
The Statistics of the Gravitational Field Arising from a Random Distribution of Stars, I. With S. Chandrasekhar. Astrophys. J . 95:489531 [VI, 12].
Note to „Tabulation of the Probabilities for the Ratio of the Mean Square Successive Difference to the Variance” by B. I. Hart. Ann . Math. Stat. l3:207214 [IV, 36].
Approximative Properties of Matrices of High Finite Order. Portugaliae Math. 3:162 [IV, 24].
Theory of Detonation Waves. Progress Report to the National Defense Research Committee Div. B, OSRD549, (April 1, 1942. PB 31090), May 4. 34 pp. [VI, 20].
1943
On Rings of Operators, IV. With F. J. Murray. Ann . Math. 44:716808 [III, 5].
The Statistics of the Gravitational Field Arising from a Random Distribution of Stars, II.
With S. Chandrasekhar. The Speed of Fluctuations; Dynamical Friction; Spatial Correlations. Astrophys. J . 97:127 [VI, 13].
On Some Algebraical Properties of Operator Rings. Ann. Math. 44 :709715 [III, 8].
On Oblique Reflection and Collison of Shock Waves. With R. J. Seeger. PB 31918, September 20. 3 pp. Theory of Shock Waves. Progress report to the National Defense Research Committee,
Div. 8, U. S. Dept. Comm. Off. Tech. Serv. (Aug. 31, 1942.) PB 32719, January 29. 37 pp. [VI, 19].
Oblique Reflection of Shocks. Explosives Research Report No. 12, Navy Dept.,
Bureau of Ordnance, U.S. Dept. Comm. Off. Tech. Serv. PB 37079, October 12. 75 pp. [VI, 22].
1944
Theory of Games and Economic Behavior. With O. Morgenstern. Princeton University Press,
(1st ed., Princeton, 1944, 625 pp.; 2d ed., Princeton, 1947, 641 pp.; 3d ed., Princeton, 1953, 641 pp.) German trans. by Docquier.
Proposal and Analysis of a New Numerical Method for the Treatment of Hydrodynamical Shock Problems.
AMP Report 108.1R AMGIAS 1. Submitted by the Applied Mathematics Group, Institute for Advanced Study to the Applied Mathematics Panel,
National Defense Research Committee, March 20th, OSRD3617. 31 pp. [VI, 27].
Introductory Remarks (Sec. I), Theory of the Spinning Detonation (Sec. Theory of the Intermediate Product (Sec. XIII). Report of the Informal Technical Conference on the Mechanism of Detonation. AM570,
April 10. 19 pp.
Riemann Method; Shock Waves and Discontinuities (onedimensional), TwoDimensional Hydrodynamics.
Shock Hydrodynamics and Blast Waves, by H. A. Bethe, K. Fuchs, J. von Neumann, R. Peierls and W. G. Penney. Notes by J. O. Hirschfelder. AECD2860, October 28. 106 pp.
1945
Refraction, Intersection and Reflection of Shock Waves. Conference on Supersonic Flow and Shock Waves, held March 15, Navy Bureau of Ordnance, NAVORD Report 203, AM1663, July 16, 412 [VI, 23].
Flying Wind Tunnel Experiments. With A. H. Taub. PB 33263, November 5. 16 pp. Random Ergodic Theorems. With S. M. Ulam. Bull. Amer. Math. Soc. 51 :660.
1946
Solution of Linear Systems of High Order. With V. Bargmann and D. Montgomery.
Report prepared for Navy Bureau of Ordnance, under Contract Nord9596, October 25. 85 pp. [V, 13].
Preliminary Discussion of the Logical Design of an Electronic Computing Instrument.
Part I, I. With A.W. Burks and H. H. Goldstine. Report prepared for the
U. S. Army Ord. Dept. under Contract W36034ORD7481. 42 pp. [V, 2].
The CrossSpace of Linear Transformations, II. With R. Schatten. Bull. Amer. Math. Soc. 52:67. The CrossSpace of Linear Transformations, II. With R. Schatten. Ann. Math. 47: 608630 [IV, 29].
1947
The Mathematician. The Works of the Mind, ed. by R. B. Heywood. University of Chicago Press, 180196 [I, 1]. The Future Role of Rapid Computing. Meteorology, Aeronautical Engineering Review, 6, 4:30.
Numerical Inverting of Matrices of High Order. With H. H. Goldstine.
Bull. Amer. Math. Soc. 53:10211099 [V, 14].
Planning and Coding of Problems for an Electronic Computing Instrument. Part II, I. With H. H. Goldstine.
Report prepared for U. S. Army Ord. Dept. under Contract W36034ORD7481. 69 pp. [V,3].
Statistical Methods in Neutron Diffusion. With R. D. Richtmyer.
Los Alamos Sci. Lab. Rept. LAMS551, April 9. 22 pp. [V, 21].
The Point Source Solution. Chapt. 2 of Blast Wave , Los Alamos Sci. Lab. Tech Series, VII Pt. II, LA2000, ed by H. Bethe, August 13, 2755 [VI, 21.]
The Mach Effect and the Height of Burst. (Declassified) With F. Reines. Part of Chapt. 10 of Blast Wave.
LA2000, ed by H. Bethe, August 13, pp. X11–X84 [VI, 24].
On the Numerical Solution of Partial Differential Equations of Parabolic Type.
With R. D. Richtmyer. LA657, December 25. I7 pp. [V, 18].
On the Euclidean Character of the Perpendicularity Relation. With E. R. Lorch. Bull. Amer. Math. Soc. 53:489. On the Group of Homeomorphisms of the Surface of the Sphere. With S. Ulam. Bull. Amer. Math. Soc. 53:506. On Combination of Stochastic and Deterministic Processes. Bull. Amer. Math. Soc. 53:1120.
Some Estimates on the Numerical Stability of the Elimination Method for Inverting Matrices of High Order.
With H. H. Goldstine. Bull. Amer. Math. Soc. 53:1123.
1948
Planning and Coding of Problems for an Electronic Computing Instrument. Part II, II. With H. H. Goldstine. Report prepared for U. S. Army Ord. Dept.
under Contract W36034ORD7481. 68 pp. [V,4].
Planning and Coding of Problems for an Electronic Computing Instrument. Part II, III. With H. H. Goldstine. Report prepared for
U. S. Army Ord. Dept. under Contract W36034ORD7481. 23 pp. [V,5].
On the Theory of Stationary Detonation Waves. File X122, Ballistic Research Laboratory, Aberdeen Proving Ground, Md., September 20. 26 pp.;
The CrossSpace of Linear Transformations, III. With R. Schatten. Bull. Amer. Math. Soc. 54:637 The CrossSpace of Linear Transformations, III. With R. Schatten. Ann. Math. 49:557582 [IV, 30].
1949
Wiener’s „Cybernetics”, Review. Physics Today 2:3334.
On Rings of Operators. Reduction Theory. Ann. Math. 50:40l485 [III, 7].
1950
A Method for the Numerical Calculation of Hydrodynamic Shocks.
With R. D. Richtmyer. J. Appl. Phys. 21:232237 [VI, 28].
Functional Operators. I: Measures and Integrals, II: The Geometry of Orthogonal Spaces Ann. Math. Studies, Nos. 21 and 22, Princeton University Press, 261, 107 pp.
Solutions of Games by Differential Equations. With G. W. Brown. Contributions to the Theory of Games.
Ann. Math. Studies, 24, Princeton Univ. Press, 7379 [VI, 4]. Statistical Treatment of Values of First 2000 Decimal Digits of e,
Calculated on the ENIAC. With N. C. Metropolis and G. Reitwiesner. Math. Tables and Other Aids to Comp. 4:109111 [V, 22].
Numerical Integration of the Barotropic Vorticity Equation.
With J. G. Charney and R. Fjörtoft. Tellus 2:237254 [VI, 30]. A Theorem on Unitary Representations of Semisimple Lie Groups.
With I. E. Segal. Ann. Math. 52:509517 [IV, 25].
1951
Eine Spektraltheorie für allgemeine Operatoren eines unitären Raumes. Math. Nachr . 4:258281 [IV, 26]. The Future of HighSpeed Computing. Digest of an address at the IBM Seminar on Scientific Computation,
November, 1949, Proc. Comp. Sem., I.B.M., 13 [V, 6].
Discussion on the Existence and Uniqueness or Multiplicity of Solutions of the Aerodynamical Equations.
Chapter 10 of Problems of Cosmical Aerodynamics, Proceedings of the Symposium on the Motion of Gaseous Masses of Cosmical Dimensions held at Paris,
August 1619, 1949. Central Air Doc. Office, 7584 [VI, 25].
Numerical Inverting of Matrices of High Order, II.
With H. H. Goldstine. Proc. Amer . Math. Soc . 2:188202 [V, 15].
Various Techniques Used in Connection with Random Digits.
Chapter 13 of Proceedings of Symposium on „ Monte Carlo Method”,
held June, July 1949 in Los Angeles, Summary written by G. E. Forsythe. J. Res . Nat. Bur. Stand., Appl. Math. Series, 12:3638 [V, 23].
The General and Logical Theory of Automata. Cerebral Mechanisms in Behavior – The Hixon Symposium, September 20, 1948, Pasadena, ed. by
L. A. Jeffress (John Wiley, New York), 131 [V, 9].
1952
Discussion Remark Concerning Paper of C. S. Smith, Grain Shapes and Other.
Metallurgical Applications of Topology.
Metal Interfaces, Amer. Soc. for Metals, Cleveland, Ohio, 108110 [VI, 41].
Five Notes on Continuous Geometry. Prepared by W. Giwens, Univ. of Tenn. Includes nos. 66, 67, 68, 73, 74.
1953
A Certain ZeroSum TwoPerson Game Equivalent to the Optimal Assignment Problem.
Seminar talk, October 26, 1951, Notes by H. Rogers, Jr.,
Contributions to the Theory of Games, II. (Ann. Math. Studies, No. 28), Princeton University Press, 5–12 [VI, 5]. Two Variants of Poker. With D. B. Gillies and J. P. Mayberry. Contributions to the Theory of Games, II.
(Ann. Math. Studies, No. 28), Princeton University Press, 13–50 [VI, 6] [Supplement to 108.].
A Numerical Study of a Conjecture of Kummer.
With H. H. Goldstine. Math. Tables and Other Aids to Comput . 7:133–134 [V, 24].
Communication on the Borel Notes. Econom. 21:124–125 [VI, 2]. Taylor Instability at the Boundary of Two Incompressible Liquids.
With E. Fermi. Los Alamos Sci. Lab. Rept. AECU2979, Part II, August 19, 7–13 [VI, 31].
1954
Significance of Loewner’s Theorem in the Quantum Theory of Collisions.
With E. P. Wigner. Ann. Math. 59:418–433 [IV, 27]. The Role of Mathematics in the Sciences and in Society.
Address at 4th Conference of Association of Princeton Graduate Alumni, June, 16–29 [VI, 35].
A Numerical Method to Determine Optimum Strategy. Naval Res. Logistics Quart. 1:109–115 [VI, 7]. The NORC and Problems in High Speed. Address in the occasion of the first public showing of the
IBM Naval Ordnance Research Calculator, December 2 [V, 7]. Entwicklung und Ausnutzung neuerer mathematischer Maschinen.
Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes NordrheinWestfalen, Fasc. 45, Düsseldorf [V, 8].
1955
Continued Fraction Expansion of 21/3. With B. Math. Tables and Other Aids to Comput.,9:23–24 [V, 25]. On the Permutability of SelfAdjoint Operators. With A. Devinatz and A. E. Nussbaum.
Ann. Math. 62:199–203 [IV, 28]
Blast Wave Calculation. With H. H. Goldstine. Comm. Pure Appl. Math. 8:327–353 [VI, 29].
Method in the Physical Sciences. The Unity of Knowledge, ed by L. Leary, Doubleday, 157–164 [VI,36]. Can we Survive Technology? Fortune, June [VI, 38].
Impact of Atomic Energy on the Physical and Chemical Sciences. Speech at M.I.T. Alumni Day Symposium, June 13, Summary, Tech. Rev., Nov. 15–17 [VI, 39].
Defense in Atomic War. Paper delivered at a symposium in honor of Dr. R. H. Kent, December 7, 1955, The Scientific Bases of Weapons, Journ. Am. Ordnance Assoc., 21–23 [VI, 40].
1956
Probabilistic Logics and the Synthesis of Reliable Organisms from Unreliable Components.
January 1952, Calif. Inst. of Tech., Lecture notes taken by R. S. Pierce and revised by the author, Automata Studies, ed. by C. E. Shannon and J. McCarthy, Princeton University Press, 43–98 [V, 10].
The Impact of Recent Developments in Science on the Economy and on Economics.
Partial text of a talk at the National Planning Assoc., Washington, D. C., December 12, 1955, Looking Ahead 4:11 [VI,11].
1958
The Computer and the Brain. (Silliman Lectures.) Yale University Press. 82 pp.
The NonIsomorphism of Certain Continuous Rings (with introduction by I. Kaplansky).
Ann. Math. 67:485–496 [IV, 14].
1959
The Jacobi Method for Real Symmetric Matrices. With H. H. Goldstine and F. J. Murray.
Revised version of a lecture presented August 1951 on a Los Angeles Symposium at the National Bureau of Standards, J. Assoc. Computing Machinery 6:59–96 [V, 16].
A Study of a Numerical Solution to a TwoDimensional Hydrodynamical Problem.
With A. Blair, N. Metropolis, A. H. Taub and M. Tsingou. Condensation of Los Alamos Sci. Lab. Report. LA2165, Math. Tables and Other Aids to Comput. 13:145–187 [V, 17].
1960
Continuous Geometry, with an introduction by I. Halperin, Princeton University Press. 229 pp.
1961
Comparison of Cells. Manuscript, reviewed by G. Hunt, Collected Works, II:558 [II, 27]. Characterization of Factors of Type II1.
Draft manuscript, reviewed by I. Kaplansky, Collected Works, III:562–563 [III, 10].
1962
Independence of F (from the Sequence). Manuscript, reviewed by I. Halperin, Collected Works, IV:189–190 [IV, 15].
Continuous Geometries with a Transition Probability. Manuscript, 1937, reviewed by I. Halperin, Collected Works, IV:191–194 [IV, 16].
Quantum Logistics (Strictand ProbabilityLogics). Manuscript, unfinished, ca. 1937, reviewed by A. H. Taub, Collected Works, IV:195–197 [IV, 17].
Lattice Abelian Groups. Manuscript, 1940, reviewed by G. Birkhoff, Collected Works, IV:198–199 [IV, 18]. Measure in Functional Spaces. Manuscript, prob. 1934–35, reviewed by I. Halperin,
Collected Works, IV:435–438 [IV, 31].
Representation of Certain Linear Groups by Unitary Operators in Hilbert Space. Manuscript, 1939, reviewed by G. W. Mackey, Collected Works, IV:439–441 [IV, 32].
1963
On the Principles of Large Scale Computing Machines. With H. H. Goldstine.
Lecture manuscript, prior to May 15, 1946, Collected Works, V:1–33 [V, 1].
NonLinear Capacitance or Inductance Switching. Amplifying and Memory Devices, Basic paper for Patent 2,815,488, field April 28, 1954, granted December 3, 1957, assigned to IBM, Collected Works, V:379–419 [V, 11].
Notes on the Photon Disequilibrium Amplification Scheme. Manuscript, September 16, 1953, reviewed by J. Bardeen, Collected Works, V: 420 [V, 12].
First Report on the Numerical Calculation of Flow Problems. Prepared for Standard Oil Development Company, June 22–July 6, 1948, Collected Works, V:664–712 [V, 19].
Second Report on the Numerical Calculation of Flow Problems. Prepared for Standard Oil Development Company, July 25–August 22, 1948, Collected Works, V:713–750 [V, 20].
Discussion of a Maximum Problem. Typescript, November 15–16, 1947. ed. by H. W. Kuhn and A. W. Tucker, Collected Works, VI:89–95 [VI, 8].
A Numerical Method for Determination of the Value and the Best Strategies of a ZeroSum TwoPerson Game with Large Numbers of Strategies. Manuscript/ Mimeograph, 1948,
reviewed by H. W. Kuhn and A. W. Tucker, Collected Works, VI: 96–97 [VI, 9].
Symmetric Solutions of Some General N Person Games. Manuscript, 1946, reviewed by D. B. Gillies, Collected Works, VI:98–99 [VI, 10].
Static Solutions of Einstein field Equations for Perfect Fluid with . Manuscript, 1935, reviewed by A. H.Taub, Collected Works, VI :172 [VI, 14].
On Relativistic Gas Degeneracy and the Collapsed Configurations of Stars. Notes, 1935, reviewed by A. H. Taub, Collected Works, VI:173–174 [VI, 15].
The Point Source Model. Manuscript, reviewed by A. H. Taub, Collected Works, VI:175 [VI, 16]. The Point Source Solution, assuming a Degeneracy of the SemiRelativistic Type,
p = K( 4/3, Over the Entire Star. Manuscript, reviewed by A. H. Taub, Collected Works, VI:176 [VI, 17] Discussion of De Sitter’s Space and of Dirac’s Equation in it. Manuscript, 1940,
reviewed by A. H. Taub, Collected Works, VI:177 [VI, 18].
Use of Variational Methods in Hydrodynamics. Memorandum to O. Veblen, March 26, 1945, Collected Works, VI:357–360 [VI, 26].
The Taylor Instability Problem. Manuscript, ca. 1953,
reviewed by H. H. Goldstine, Collected Works, VI:435–436 [VI, 32].
Recent Theories of Turbulence. Report to the Office of Naval Research, 1949, Collected Works, VI:437–472 [VI, 33].
Description of the Conformal Mapping Method for the Integration of Partial Differential Equation Systems with 1+2 Independent Variables. Manuscript, December 16, 1950, – January 8, 1951,
reviewed by A. H. Taub, Collected Works, VI:473–476 [VI, 34].
Statement Before the Special Senate Committee on Atomic Energy. Manuscript,
prepared prior to the January 31, 1946, hearing, Collected Works, VI :499–502 [VI, 37], [For minutes of the actual testimony cf. Atomic Energy Act of 1946, U.S. Printing Office].
1966
Theory of selfreproducing Automata. Edited and completed by A. W. Burks, University of Illinois Press, Urbana.
1981
First Draft of a Report on the EDVAC. Report prepared for the
U.S. Army Ordnance Department and the University of Pennsylvania, under Contract W670ORD4926, June 30, Summary Report 2,
ed. by J. P. Eckert, J. W. Mauchly and S. R. Warren, July 10,
Published in N. Stern. From ENIAC to UNIVAC. Digital Press, Bedford, MA, 177246.
Appendix B : Abkürzungen von Zeitschriften, Nummern mit Beiträgen von JvN
Abh. Math. Semin. Hamb. – Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Hamburgischen Universität (Leipzig) 35
Acta Szeged. – Acta Literarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco Josephinae. Sectio Scien tiarum Mathematicarum (Szeged) 2, 5
Actualités Scient. et Industr. – Actualités Scientifiques et Industrielles (Paris) 64
Ann. Math. Stat. – The Annals of Mathematical Statistics (Baltimore, Md.) 92, 94, 98, 101
Ann. Math. – Annals of Mathematics. Second Series. (Princeton, N.J.) 36, 42, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 62, 66, 68, 69,
73, 79, 88, 89, 90, 99, 104, 106, 120, 137, 139, 145, 159, 165, 174
Ann. Math. Studies – Annals of Mathematics Studies (Princeton, N.J.) 141, 142, 154, 155 Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes NordrheinWestfalen 163
Astrophys. J. – The Astrophysical Journal (Chicago, Ill.) 100, 105
Bull. Amer. Math. Soc. – Bulletin of the American Mathematical Society (Providence, R. I.) 55, 58, 60, 63, 71, 77, 78,
80, 87, 97, 116, 119, 123, 129, 130, 131, 132, 136
C. R. Acad. Sci. – Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l’Académie des Sciences (Paris) 19 Comm. Pure Appl. Math. – Communications on Pure and Applied Mathematics (New York) 166 Compos. Math. – Compositio Mathematica (Groningen) 54, 86
Econom. – Econometrica. Journal of the Econometric Society 157
Erg. eines Math. Coll. – Ergebnisse eines Mathematischen Seminar 85 Erkenntnis – Erkenntnis, zugleich Annalen der Philosophie (Leipzig) 40 Fortune – Fortune (Chicago) 168
Fund. Math. – Fundamenta Mathematicae (Warszawa) 15, 30, 31, 39, 67
Gött. Nachr. – Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 9, 10, 11
Izv. Tomsk. Gos. Univ. – Izvestia nauchnoissledovatelskogo Instituta Matematiki i Mechaniki pri Tomskom Gosudarstvennom Universitete Im. Kujbysheva V. V. 82
J. Appl. Phys. – Journal of Applied Physics (New York) 140
J. Assoc. Computing Machinery – Journal of the Association for Computing Machinery 175
J. f. Math. – Journal für die reine und angewandte Mathematik (Berlin) 3, 25, 34, 37
J. Res. Nat. Bur. Stand. – Journal of Research of the National Bureau of Standards (Washington) 150 Jahresb. Dtsch. Math. Verein. – Jahresbericht der Deutschen MathematikerVereinigung (Stuttgart) 1,14 Mat. és Természettud. Értesítõ – Matematikai és Természettudományi Értesítõ (Budapest) 52
Mat. Sborn – Matematicheskii Sbornik (Moscow) 70, 72
Math. Ann. – Mathematische Annalen (Berlin–Göttingen–Heidelberg) 7, 16, 17, 18, 32, 33, 38 Math. Nachr. – Mathematische Nachrichten (Berlin) 146
Math. Phys. Lapok – Mathematikai és Physikai Lapok (Budapest) 4
Math. Tables and Other Aids to Comp. – Mathematical Tables and Other Aids to Computation (Washington) 143, 156, 164, 176
Math. Zschr – Mathematische Zeitschrift (Berlin – Göttingen – Heidelberg) 12, 20, 26, 41 Meteorology, Aeronautical Engineering Review 122
Naval Res. Logistics Quart. – Naval Research Logistics Quarterly (Washington) 161 Phys. Zschr. – Physikalische Zeitschrift (Leipzig) 27, 28
Physics Today 138
Portugaliae Math. – Portugaliae Mathematica (Lisbon) 102
Proc. Amer. Math. Soc. – Proceedings of the American Mathematical Society 149
Proc. Nat. Acad. Sci. – Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (Washington) 43, 44, 45, 57, 65, 74, 75, 76, 83, 84
Rev. Econ. Studies – Review of Economic Studies 85
Sitzungsber. d. Preuss. Akad. Wiss. – Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Physikalis chmathematische Klassen (Berlin) 8
Tech. Rev. – Technical Review 169
Tellus – Tellus. A Quarterly Journal of Geophysics (Stockholm) 144
Trans. Amer. Math. Soc. – Transactions of the American Mathematical Society 56, 59, 61, 81, 93
Zschr. f. Phys. – Zeitschrift für Physik 21, 22, 23, 24, 29
Abkürzungen und Acronyme
AEC Atomic Energy Commission CatB The Computer and the Brain CE(s) Computing Element(s) CSP Control Sequence Point
IAS Institute for Advanced Studies (Princeton, USA)
JvN John von NeumannReferences
OM Oskar Morgenstern
PDS Pulse Density System
ToG Theory of Games and Economic Behaivour
Notes
1 Biographische Daten sind auch im Vorwort von Mrs. von Neumann zu “The Computer and the Brain” zu finden
1 Die Silliman Lectures, als eine der ältesten und bedeutendsten in den USA, finden jährlich zum Gedenken an Mrs. Hepsa Ely Silliman, der Gründerin der gleichnamigen Stiftung, statt und werden von besonders heraus ragenden Wissenschaftlern gehalten. Ihr Zweck soll sein das göttliche Wirken in der Natur und der Welt aufzuzeigen. Dazu seien nach Ansicht der Gründerin Naturwissenschaften und Geschichtswissenschaften im Gegensatz zur Theologie in der Lage.
2 Norman Macrae spricht in diesem Zusammenhang von „einem verpfuschten Stück Fliegerei “
3 Jedoch war diese Idee eines Präventivkrieges unter Intellektuellen verbreitet. Es herrschte die Auffassung, daß die Weigerung der Franzosen und Engländer, die Remilitarisierung des Rheinlandes durch Hitler zu verhindern, die Toten des Zweiten Weltkrieges mitverschuldet hätte. Ein entschlossenes, vorbeugendes Vorgehen gegen eine Katastrophe zu propagieren, war also in den Augen vieler Zeitgenossen eine moralisch vertretbare Option.
4 Abraham Wald führte 1935, 1936, der NeisserStackelbergZeuthen Kritik am WalrasCassel Gleichungssys tem folgend, Ungleichungen in die Faktor Markt Clearing Gleichungen ein.
5 Auf A.Wald geht bemerkenswerterweise eine innovative Arbeit aus dem Jahr 1945 zurück [72]
6 Die Vorträge werden üblicherweise in einem Zeitraum von zwei Wochen gehalten und anschließend von der Yale University als Buch veröffentlicht.
References
Marx G: Remembering the student years. Középiskolai Matematikai Lapok, 1994, Sonderausgabe.
dr . str angelove or : how I learned to stop worrying and love the bomb [ http://www.filmszene.de/gold/seltsam.html ].
Heims S: John von Neumann and Norbert Wiener. Cambridge, MA: MIT Press, 1980.
Ulam SM: John von Neumann, 19031957. Bulletin of the American Mathematical Society, 1958, 64:1–49.
Zum 100. Geburtstag von John von Neumann [ http://www.clabs.net/zone4/vonNeumann/webquellen/[301105][heise zum ].
100sten][www.heise.de_newsticker_meldung_43228.pdf
von Neumann J, Burks AW: Theory of SelfReproducing Automata, edited and completed by Arthur W.Burks. University of Illinois Press, 1966.
John von Neumann 19031957 [ http://www.clabs.net/zone4/vonNeumann/webquellen/%5B021205%5Dwww.computermuseum.fhkiel.de_virtuel
nms_ahnen_neumann.htm.pdf].
John Louis von Neumann [ http://www.clabs.net/zone4/vonNeumann/webquellen/%5B041205%5Dei.cs.vt.edu_~history_VonNeumann.html].
Macrae N: John von Neumann. Mathematik und Computerforschung Facetten eines Genies. Basel, Birkhäuser Verlag, 1994.
Teller E : Memoirs. ATwentiethCentury Journey in Science and Politics. Cambridge, MA: Perseus Publish ing, 2002.
John von Neumann. Mathematik und Computerforschung Facetten eines Genies. Basel, Birkhäuser Verlag, 1994.
Rhodes R: The making of the atomic bomb. New York, Touchstone, 1995.
Ulam S: In: Adventures of a mathematician. NY: Charles Scribner’s Sons, 1976.
Schweber SS: In the Shadowof the Bomb. Oppenheimer, Bethe, and the Moral Responsibility of the Scientist. Princeton, Princeton University Press, 2000.
John von Neumann’ s 100th Birthday [ http://www.stephenwolfram.com/publications/informalessays/neumann/ ].
Morgenstern O: Wirtschaftsprognose, Eine Untersuchung ihrer Voraussetzungen und Möglichkeiten. Wien, Springer Verlag, 1928.
Oskar Morgenstern, 19021976. [ http://cepa.newschool.edu/het/profiles/morgenst.htm ].
Oskar Morgenstern [ http://de.wikipedia.org/wiki/Oskar_Morgenstern ].
Schmidt C: Game Theory and Economic Analysis, A quiet revolution in economics. London, Routledge Advances in Game Theory, 2002.
Mirowski P: When games grow deadly ser ious: the military influence on the evolution of game theory In: Economics and National Security, History of Political Economy (Edited by: Goodwin CD ). Durham and London: Duke University Press, 1992, 227–256.
Leonard RJ: Creating a context for game theory In: Toward a History of Game Theory, annual supplement to History of Political Economy. Durham,: Duke University Press, 1992, 29–76.
Granger CW, Morgenstern O : The Predictability of Stock Market Prices. Lexington, MA: D. C. Heath, 1970.
Schotter A: Selected Economic Writings of Oskar Morgenstern. New York, New York University Press, 1976.
Morgenstern O, Thompson GL: Mathematical Theory of Expanding and Contracting Economies. Lexington, MA: D.C. Heath.
von Neumann J: Zur Theorie der Gesellschaftsspiele. Mathematische Annalen der, 1928, 100:295–320.
von Neumann J: Sur la théorie des jeux. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences, 1928, 186:1689–1691.
Morgenstern O: Vollkommene Voraussicht und wirtschaftliches Gleichgewicht. Zeitschrift für Nation alökonomie, 1935, 6:337–357.
Morgenstern O: The time moment in value theory In: Selected Economic Writings of Oskar Morgenstern
(Edited by: Schotter A ). New York: University Press, 1976, 151–167.
Morgenstern O: The Collaboration between Oskar Morgenstern and John von
Neumann on the Theory of Games In: The Theory of Games and Economic Behaviour. Princeton Press, 1976, 712–726.
Burks Ed. AW, von Neumann J : Theory of selfreproducing Automata. NY, JohnWiley & Sons, 1966.
Ulam S: A Collection of Mathematical Problems. New York, Interscience Publishers, 1960.
von Neumann K: Preface In: The Computer and the brain. Yale University Press, 1958.
von Neumann J: Yale University Press, 1958.
Poundstone W: Prisoner’s Dilemma. New York, Anchor Books, 1993.
[ http://www.artsci.wustl.edu/~freiwald/szego.html ].
Hermann A: Werner Heisenberg in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Rowohlt, Reinbek, 1976.
Gott sei Dank, wir konnten sie nicht bauen. Der Spiegel, 1976.
Groves LR: Memorandum for the Secretary of War, 18 July 1945. 1945. http://www.nuclearfiles.org/
Irving D: Der Traum von der deutschen Atombombe. Gütersloh, Bertelsmann, 1969.
Stone J: Conscience, Arrogation and the Atomic Scientists. of the Federation of American Scientists, 2004, 47.
Easle B: Väter der Vernichtung. Männlichkeit, Naturwissenschaftler und der nukleare Rüstungswettlauf. Reinbek, Rowohlt Taschenbuchverlag, 1986.
Jungk R: Brighter Than AThousand Suns. London, Penguin Books, 1980.
Working With Fermi at Chicago and Postwar Los Alamos [ http://www.fas.org/RLG/010929fermi.htm ].
Jungk R: Die Zukunft hat schon begonnen. Amerikas Allmacht und Ohnmacht. Bern, Alfred Scherz Verlag, 1957.
Rhodes R: Dark sun. The making of the hydrogen bomb. NY, Touchstone, 1996.
Dyson FJ: History without Hindsight. Technology Review.
York HF: Race to Oblivion. A Participant’s View of the Arms Race. New York, Simon & Schuster, 1970.
Regis E: Who Got Einstein’s Office? Eccentricity and Genius at the Institute for Advanced Study. Harmond sworth, Penguin Books, 1989.
Sagan C: Atomkrieg und Klimakatastrophe. München, Droemer Knaur, 1984.
Dwight D. Eisenhower, Address to the UN General Assembly, 8 December 1953, Nuclear Age Peace Founda tion. http://www.nuclearfiles.org/redocuments/1953/531208ikeafp.html, 27.05.2004.
Befor e Personnel Security Board, Washington, DC, United States Government Printing Office Washing ton, 1954 [ http://www.pbs.org/wgbh/amex/bomb/filmmore/reference/primary/tellertestimony.html ].
Schmidt C: Game theory and economics: an histor ical survey. Revue d’Économie Politique, 1990, 100:589– 618.
Lancester FW: Mathematics in war far e In: Aircraft in Warfare. Reprinted in J. R. Newman 1956, 1916, 2138–2159.
Richardson LF: In: The Mathematical Psychology of War. Oxford, W.Hunt, 1919.
Borel E: La théorie du jeu et les équations, intégrales à noyau symétrique gauche. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences, 19921, 173:1304–1308.
Borel E: Sur les jeux où interviennent l’hasar d et l’habilité des joueurs In: Théorie des probabilités. Paris: 1924.
Borel E: Sur les systèmes de for mes linéaires à déterminant symétrique gauche et la théorie générale du jeu. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences, 1927, 184:52–53.
Dimand RW, Dimand MA: The early history of the theory of str ategic games fr om Waldegrave to Borel. E. R. Weintraub, 1992, 15–28.
Zermelo E : Über eine Anwendung der Mengenlehre auf die Theorie des Schachspiels. Proceedings, Fifth International Conference of Mathematicians, 1913, 2:501–504.
Kuhn H, Tucker W: Contributions to the Theory of Games. Princeton, Princeton University Press, 1958.
Borel E: Applications des jeux de hasard, tome 4, fascicle 2 In: Traité du calcul des probabilités et de ses applications. Paris: GauthierVillars, 1938.
Rellstab U: New insights into the collaboration between John von Neumann and Oskar Morgenstern on ‘On the Theory of Games and Economic Behaviour’ In: Towards a History of the Game Theory (Edited by: Weintraub ER ). Durham: Duke University Press, 1992, 77–93.
Morgenstern O: Mathematical economics In: Encyclopedia of the Social Sciences. New York: Macmillan, 1931, 364–368.
Beaumol WJ: Precursors in Mathematical Economics. London, London school of Economics, LSE, 1968.
von Neumann J: Über ein ökonomisches Gleichungssystem und eine Verallgemeinerung des Brouwer schen Fixpunktsatzes. Ergebnisse eines mathematischen Kolloquiums, 1937, 8:73–83.
Morgenstern O: Professor Hicks on Value and Capital. Journal of Political Economics, 1941, 49:361–393.
Wald A: On the Unique NonNegative Solvability of the New Production Functions (Par t I) In: Ergebnisse eines mathematischen Kolloquiums (Edited by: Menger ). 1935.
Wald A: On the Unique NonNegative Solvability of the New Production Functions (Par t II) In: Ergeb nisse eines mathematischen Kolloquiums (Edited by: Menger ). 1935.
Ville J: Sur la Theorie Generale des Jeux ou intervient l’Habilite des Joueurs In: Traite du Calcul des Probabilites et de ses Applications (Edited by: Borel E ). Paris: GautierVillars, 1938, 105–113.
Hurwicz L: The theory of economic behavior . American Economic Review, 1945, 36:909–936.
Marschak J : Neumann’s and Morgenstern’s new approach to static economics. Journal of Political Econ omy, 1946, 54:97–115.
Wald A: Generalization of a theorem by Von Neumann concerning zerosum twoper son games. Annals of Mathematics, 1945, 46:281–286.
Neumann Jv: The Mathematician. Chicago, University of Chicago Press, 1947.
Aspray W: John von Neumann and the Origin of Modern Computing. Cambridge, MA: MIT Press, 1990.
van der Waerden BL: Sources of Quantum Mechanics. Dover Books, 1968 .
Duck I , Sudarshan EC: 100 Years of Planck’ s Quantum. World Scientific, 2000.
Greiner W: Grundlagen der Quantenmechanik. New York, Springer, 1989.
Dirac PA: The principles of Quantum Mechanics. Cambridge, Cambridge University Press, 1957.
Hove Lv: Von Neumann’ s contributions to quantum theory. Bulletin of The American Mathematical Society
, 1958, 64:95–99.
Neumann Jv, Hilbert D, Nordheim L: Über die Grundlagen der Quantenmechanik. Math. Annalen, 1927, 98.
Isham C: Lectures on Quantum mechanics: Mathematical and structural foundations. Imperial College Press, 1995.
Barrett J : The Quantum Mechanics of Minds and Worlds. Oxford University Press, 1999.
Wheeler JA, Zurek HW: Quantum Theory and Measurement. Princeton University Press, 1984.
J
ammer M: The Philosophy of Quantum Mechanics: The Interpretations of Quantum Mechanics in Historical Perspective. WileyInterscience Publication, 1974.
Goswami A: Quantum Mechanics. Brown Publishers, 1997.
Baggott J : Beyond Measure: Modern Physics, Philosophy and the Meaning of Quantum Theory. Oxford University Press. , 2004.
Neumann Jv: Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik. Berlin, Springer, 1932.