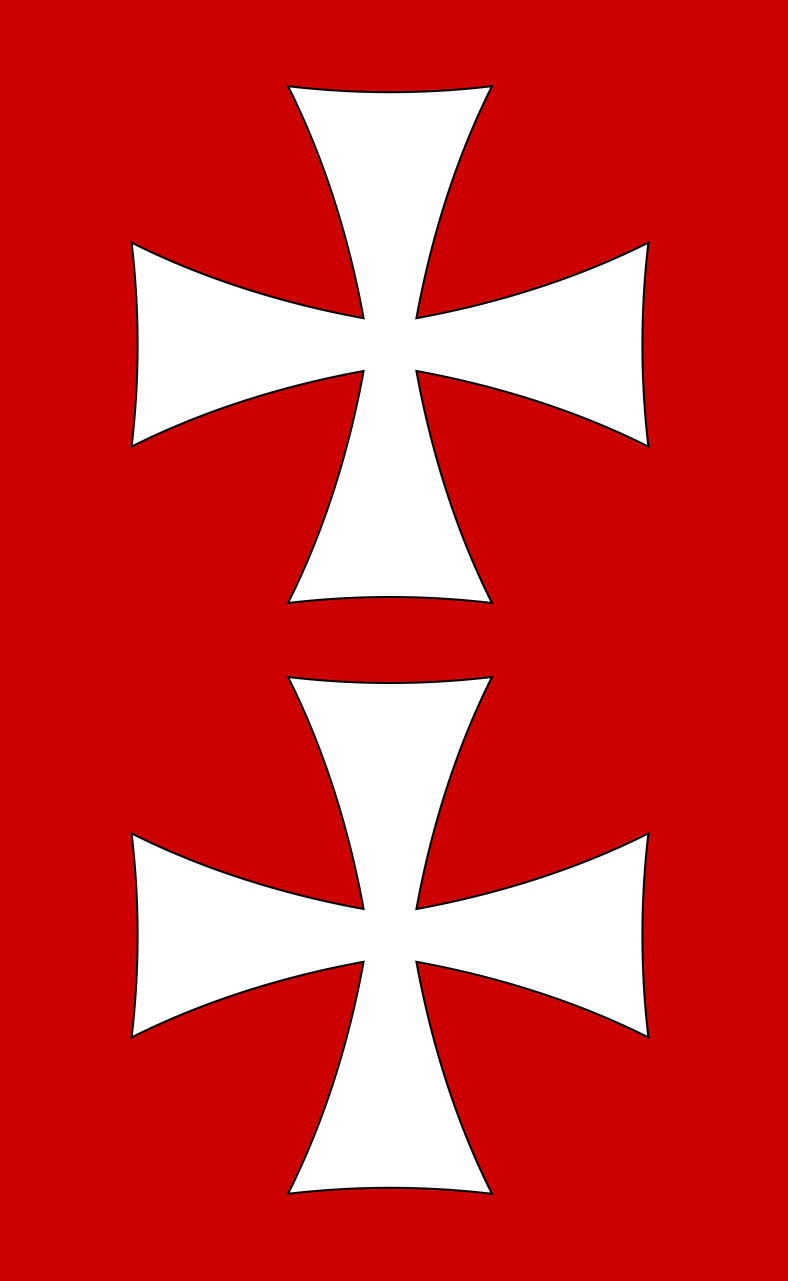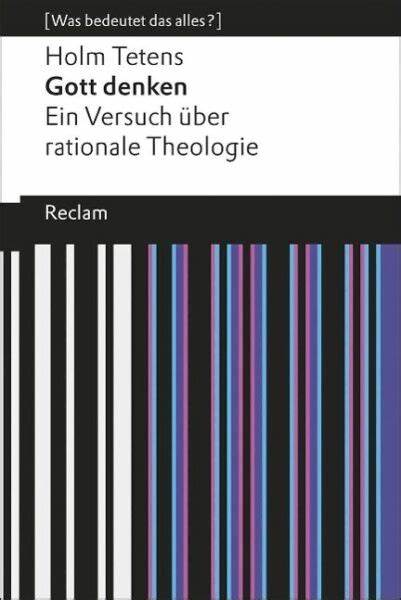Dr.Jo – Abstract
Der vorliegende Text unternimmt eine kurze Analyse von Holm Tetens’ Werk “Gott denken”, das einen markanten Beitrag zur zeitgenössischen analytischen Religionsphilosophie im deutschsprachigen Raum darstellt (Brüntrup, 2017). Tetens, ein einflussreicher Philosoph für Wissenschaftstheorie und Geist, entwirft in diesem Buch das Programm einer “Rationalen Theologie” für das 21. Jahrhundert. Sein Ansatz distanziert sich bewusst von den traditionellen metaphysischen Gottesbeweisen, deren Scheitern nach Kant er als gegeben voraussetzt. Stattdessen zielt er darauf ab, die rationale Vertretbarkeit des Theismus in einer nachmetaphysischen und wissenschaftlich geprägten Welt aufzuzeigen. Das Kernstück seiner Argumentation bildet nicht ein logisch-deduktiver Beweis, sondern ein moralisch-existentielles Argument, das den Glauben an Gott als eine Form der “vernünftigen Hoffnung” legitimiert (Gasser, 2017). Tetens’ Position wurzelt tief in der kantianischen Unterscheidung zwischen dem, was wir erkennen können (Phänomene), und dem, was wir widerspruchsfrei denken dürfen (Noumena). Er argumentiert, dass die Struktur der Welt, wie sie uns die Naturwissenschaften erschließen, in keiner Weise dem vernünftigen Denken eines Gottes widerspricht, sondern sich mit diesem sogar in Einklang bringen lässt (Tetens, 2017). Diese Arbeit zeichnet die erkenntnistheoretischen Grundlagen von Tetens’ Projekt nach, analysiert seine pragmatische Wende in der Argumentation für den Gottesglauben und verortet seine Position im Spannungsfeld zwischen Kantianismus, wissenschaftlichem Realismus und zeitgenössischen religionsphilosophischen Debatten. Dabei wird deutlich, dass “Gott denken” weniger den Versuch darstellt, Gläubige zu überzeugen, als vielmehr ein philosophisches Plädoyer für die intellektuelle Redlichkeit des Theismus unter den Bedingungen der Moderne ist.
1. Einleitung
In der intellektuellen Landschaft der Gegenwart, die maßgeblich von den Erfolgen der Naturwissenschaften und einer zunehmend säkularen Grundhaltung geprägt ist, erscheint die Rede von Gott für viele als ein Relikt vergangener Epochen. Die philosophische Auseinandersetzung mit der Gottesfrage steht seit der Aufklärung, insbesondere seit den kritischen Einwänden von David Hume und Immanuel Kant, vor der fundamentalen Herausforderung, ihre eigene Legitimität und Methodik zu rechtfertigen (Carl, 2021). In diesem anspruchsvollen Kontext positioniert sich das Werk „Gott denken“ des deutschen analytischen Philosophen Holm Tetens als ein bemerkenswerter und vielschichtiger Versuch, eine Brücke zwischen moderner Rationalität und theistischem Glauben zu schlagen (Brüntrup, 2017). Tetens unternimmt nicht weniger als den Entwurf einer „Rationalen Theologie“, die den Bedingungen eines nachmetaphysischen Zeitalters standhalten soll.
Die klassische rationale oder natürliche Theologie verfolgte über Jahrhunderte das Ziel, die Existenz Gottes und seine wesentlichen Eigenschaften durch reine Vernunftargumente, unabhängig von religiöser Offenbarung, zu beweisen. Philosophen wie Descartes argumentierten für die Möglichkeit rationaler Demonstrationen der Existenz Gottes (O’Shea, 2011). Diese Tradition sah sich jedoch mit Kants „Kritik der reinen Vernunft“ einem Wendepunkt gegenüber. Kant zeigte auf, dass die menschliche Vernunft, wenn sie versucht, die Grenzen möglicher Erfahrung zu überschreiten, um metaphysische Objekte wie Gott zu erkennen, sich unweigerlich in Widersprüche (Antinomien) verstrickt. Sein „kritisches“ Projekt lieferte scheinbar ein nachhaltiges Argument gegen die traditionelle rationale Theologie (Tomaszewska, 2022). Für Kant ist Gott kein Gegenstand theoretischen Wissens, sondern ein Postulat der praktischen Vernunft – eine notwendige Annahme für die Denkbarkeit von Moralität. Damit war die Frage, ob wir Gott erkennenkönnen, negativ beantwortet, die Frage, ob wir Gott denken können, blieb jedoch offen und wurde in einen neuen Rahmen gestellt (Carl, 2021).
An diesem Punkt setzt Holm Tetens an. Er akzeptiert die Kantianische Kritik an der spekulativen Metaphysik vollständig und unternimmt keinen Versuch, die klassischen Gottesbeweise wiederzubeleben. Sein Projekt ist in diesem Sinne dezidiert post-kantianisch. Der Titel „Gott denken“ ist programmatisch zu verstehen: Es geht nicht um ein Wissen von Gott, sondern um die Bedingungen der Möglichkeit, den Gottesgedanken in einer kohärenten und intellektuell redlichen Weise zu denken. Tetens fragt, ob ein Mensch, der das wissenschaftliche Weltbild akzeptiert und die philosophische Kritik an der Metaphysik ernst nimmt, vernünftigerweise an Gott glauben kann. Seine Antwort ist ein differenziertes Ja, das er jedoch nicht auf logische Zwangsläufigkeit, sondern auf eine Form von pragmatischer Rationalität und „vernünftiger Hoffnung“ gründet.
Die vorliegende Analyse widmet sich einer systematischen Untersuchung dieses anspruchsvollen Vorhabens. Sie verfolgt das Ziel, die argumentative Architektur von Tetens‘ „Gott denken“ kapitelweise nachzuzeichnen und kritisch zu würdigen. Im ersten Schritt (Kapitel 2) werden die Grundlagen seiner „Rationalen Theologie“ beleuchtet. Hierbei wird seine Definition des Programms, die tiefgreifende Auseinandersetzung mit den erkenntnistheoretischen Vorgaben Kants (Creek, 2018) und seine methodische Abgrenzung von idealistischen Strömungen untersucht. Im darauffolgenden Kapitel (Kapitel 3) steht die Analyse der zentralen Gottesargumente im Mittelpunkt, wobei insbesondere das von Tetens favorisierte moralisch-existentielle Argument und seine charakteristische pragmatische Wende von der Beweislogik zur vernünftigen Hoffnung herausgearbeitet werden. Kapitel 4 widmet sich spezifischen theologischen und metaphysischen Aspekten, wie der Rolle Gottes als Schöpfer der Naturgesetze und den panentheistischen Zügen in seiner Gotteskonzeption. Abschließend (Kapitel 5) erfolgt eine kritische Einordnung von Tetens‘ Ansatz in den breiteren philosophischen Diskurs, indem die Stärken und Schwächen seiner Argumentation bewertet und seine Position innerhalb der zeitgenössischen analytischen Religionsphilosophie verortet wird. Diese Arbeit soll zeigen, dass Tetens’ Buch einen wichtigen Beitrag zur Debatte über das Verhältnis von Glaube und Vernunft leistet, indem es einen Weg aufzeigt, wie theistisches Denken nach dem „Ende der Metaphysik“ philosophisch verantwortungsvoll gestaltet werden kann, ohne dabei die Errungenschaften der kritischen Philosophie seit Kant zu ignorieren (Eberhard, 2016).
2. Grundlagen einer Rationalen Theologie nach Tetens
Holm Tetens’ philosophisches Projekt in “Gott denken” basiert auf einem sorgfältig gelegten Fundament, das sowohl eine Neudefinition des Begriffs der “Rationalen Theologie” umfasst als auch tief in der Erkenntnistheorie Immanuel Kants verwurzelt ist. Bevor er seine zentralen Argumente für die rationale Vertretbarkeit des Gottesglaubens entfaltet, klärt Tetens die methodischen und epistemologischen Voraussetzungen seines Ansatzes. Dieses Vorgehen dient dazu, sein Programm von vornherein von traditionellen metaphysischen Unternehmungen abzugrenzen und auf einen Boden zu stellen, der den kritischen Einwänden der neuzeitlichen Philosophie standhält.
2.1 Die Definition und das Programm der “Rationalen Theologie”
Der Begriff der “Rationalen Theologie” besitzt eine lange Tradition, die bis in die Scholastik zurückreicht und in der Aufklärung einen Höhepunkt erlebte. Klassischerweise bezeichnet er den Versuch, die Existenz und die Attribute Gottes allein mit den Mitteln der natürlichen Vernunft, also ohne Rückgriff auf Offenbarungsquellen, zu beweisen. Tetens greift diesen Begriff bewusst auf, unterzieht ihn jedoch einer radikalen Umdeutung. Seine “Rationale Theologie” ist kein Beweisprogramm, sondern ein Rechtfertigungsprojekt. Ihr Ziel ist nicht, die Existenz Gottes deduktiv zu beweisen, sondern zu zeigen, dass der Glaube an Gott unter den Bedingungen der Moderne rational erlaubt und kohärent ist.
Tetens’ Programm ist damit wesentlich bescheidener und defensiver Natur. Es wendet sich an den aufgeklärten Zeitgenossen, der das wissenschaftliche Weltbild für wahr hält und dennoch nach der Möglichkeit fragt, den Gottesgedanken sinnvoll in sein Welt- und Selbstverständnis zu integrieren. Die zentrale These, die Tetens’ Ansatz zugrunde liegt, lautet, dass eine rationale Auseinandersetzung mit der Welt und ihren grundlegenden strukturellen Bedingungen zu keinerlei Ergebnissen führt, die der Annahme eines vernünftigen Gottes widersprechen würden (Tetens, 2017). Mehr noch: Die rationale Struktur der Welt, wie sie sich in den Naturgesetzen manifestiert, kann als konsistent mit der Idee eines göttlichen Schöpfers gedeutet werden.
Das Programm der Rationalen Theologie besteht nach Tetens somit aus zwei Hauptaufgaben:
1. Negative Aufgabe (Apologetik): Die Abwehr von Argumenten, die behaupten, der Theismus sei irrational, wissenschaftsfeindlich oder logisch inkohärent. Hierzu gehört die Auseinandersetzung mit dem Problem des Bösen, dem vermeintlichen Widerspruch zwischen göttlichem Handeln und naturgesetzlicher Kausalität sowie anderen atheistischen Einwänden.
2. Positive Aufgabe (Konstruktion): Die Entwicklung eines Gottesbegriffs und eines Verständnisses der Gott-Welt-Beziehung, das mit unserem besten wissenschaftlichen und philosophischen Wissen kompatibel ist. Es geht darum, eine plausible Erzählung anzubieten, in der die Existenz Gottes als eine sinnvolle und bereichernde Hypothese zur Erklärung der Welt und der menschlichen Existenz erscheint.
Diese Neuausrichtung verlagert den Schwerpunkt von der beweisenden Logik hin zur Plausibilität und Kohärenz. Eine “Rationale Theologie” ist für Tetens erfolgreich, wenn sie zeigen kann, dass es keine zwingenden rationalen Gründe gibt, den Theismus abzulehnen, und dass es gleichzeitig gute, wenn auch nicht zwingende, Gründe gibt, ihn als eine vernünftige Option zu betrachten (Eberhard, 2016).
2.2 Erkenntnistheoretische Vorüberlegungen: Die Denkbarkeit Gottes nach Kant
Das Fundament für Tetens’ bescheidenes Programm bildet die Erkenntnistheorie Immanuel Kants. Tetens ist durch und durch ein post-kantianischer Denker, der die “kopernikanische Wende” der Philosophie als unhintergehbar akzeptiert. Die entscheidende Weichenstellung liegt in Kants Unterscheidung zwischen dem Bereich der Phänomene (der Erscheinungen), der durch unsere Sinneserfahrung und die Kategorien des Verstandes strukturiert wird, und dem Bereich der Noumena (der “Dinge an sich”), der zwar gedacht, aber nicht erkannt werden kann.
Für die Gottesfrage hat dies weitreichende Konsequenzen. Gott, die Seele und die Freiheit sind nach Kant keine Gegenstände möglicher Erfahrung und können daher nicht Objekt theoretischen Wissens sein. Jeder Versuch, die Existenz Gottes mit den Mitteln der reinen theoretischen Vernunft zu beweisen – wie es die ontologischen, kosmologischen und physikotheologischen Beweise versuchten –, muss scheitern. Kant zeigt in der “Kritik der reinen Vernunft”, dass solche Beweisversuche auf Fehlschlüssen und der unzulässigen Anwendung von Verstandeskategorien jenseits der Erfahrungsgrenzen beruhen (O’Shea, 2011).
Tetens übernimmt diese Kritik vollständig. Er argumentiert nicht gegen Kant, sondern mit ihm. Die Unmöglichkeit eines theoretischen Gottesbeweises ist für ihn der Ausgangspunkt, nicht das Ende der philosophischen Theologie. Der entscheidende Punkt, den Tetens von Kant übernimmt, ist die Differenzierung zwischen Erkennen und Denken. Während wir Gott nicht erkennen können, ist es uns nicht nur erlaubt, sondern von unserer Vernunft sogar aufgenötigt, ihn widerspruchsfrei zu denken. Die Vernunft (Vernunft) strebt im Gegensatz zum Verstand (Verstand) nach dem Unbedingten und erzeugt dabei zwangsläufig die transzendentalen Ideen von Seele, Welt und Gott (Dyck, 2014). Diese Ideen sind zwar keine konstitutiven Prinzipien, die Wissen erzeugen, aber sie können als regulative Prinzipien dienen, die unsere Forschung leiten und unserem Denken Einheit und Zielrichtung verleihen.
Genau hier knüpft Tetens an: Der Gottesgedanke ist kein Produkt irrationalen Wunschdenkens, sondern eine von der Vernunft selbst hervorgebrachte Idee. Das Projekt der Rationalen Theologie besteht darin, die Bedingungen auszuloten, unter denen dieses “Denken Gottes” rational vertretbar ist. Die Kantianische Grundlage erlaubt es Tetens, den Vorwurf des Dogmatismus zu entkräften und gleichzeitig den Raum für eine philosophische Theologie offenzuhalten, die sich ihrer erkenntnistheoretischen Grenzen bewusst ist (Creek, 2018). Sie operiert nicht mehr im Bereich des Wissens, sondern im Bereich des vernunftgeleiteten Glaubens und der begründeten Hoffnung.
2.3 Methodische Ansätze und Abgrenzung zum Idealismus
Obwohl Tetens’ Ansatz tief in der kantianischen Erkenntniskritik verwurzelt ist, ist es entscheidend zu verstehen, dass er Kant nicht in allen Aspekten folgt. Insbesondere grenzt er sich klar vom Deutschen Idealismus ab, der sich im Anschluss an Kant entwickelte. Während Philosophen wie Fichte, Schelling und Hegel versuchten, die kantianische Lücke zwischen Denken und Sein durch spekulative Systeme zu schließen, in denen die Realität letztlich als Produkt des Geistes oder einer absoluten Idee verstanden wird, schlägt Tetens einen anderen Weg ein, der stärker dem wissenschaftlichen Realismus verpflichtet ist.
Tetens’ methodischer Ansatz ist der einer analytischen Philosophie, die auf begrifflicher Klarheit, logischer Stringenz und einer engen Anbindung an die Ergebnisse der modernen Naturwissenschaften besteht. In diesem Rahmen entwickelt er eine Position, die man als eine Form des kritischen Realismus bezeichnen kann. Gegen idealistische Interpretationen argumentiert Tetens für die Existenz einer vom menschlichen Bewusstsein unabhängigen Außenwelt. In seiner Auseinandersetzung mit dem Idealismus vertritt er die Auffassung, dass unser Glaube an die Existenz der Außenwelt eine “properly basic belief” (eine gerechtfertigte Basisüberzeugung) darstellt, die keiner weiteren inferentiellen Begründung bedarf und auch nicht sinnvoll bezweifelt werden kann (Stapleford, 2014).
Diese realistische Grundhaltung ist für sein theologisches Projekt von zentraler Bedeutung. Denn nur wenn die Welt, die die Naturwissenschaften beschreiben, als eine objektive Realität verstanden wird, kann die Frage sinnvoll gestellt werden, ob die Struktur dieser Realität auf einen intelligenten Urheber hinweist oder zumindest mit einem solchen kompatibel ist. Ein idealistischer Ansatz, der die Welt primär als Konstruktion des Geistes begreift, würde die Frage nach einem externen Schöpfer dieser Welt von vornherein anders rahmen oder sogar obsolet machen. Tetens’ Realismus erlaubt es ihm hingegen, die Erkenntnisse der Physik oder Kosmologie direkt aufzugreifen und philosophisch zu deuten.
Seine Methode ist somit eine Kombination aus:
1. Transzendentalphilosophischer Reflexion: Er fragt nach den Bedingungen der Möglichkeit, Gott rational zu denken, und übernimmt hierfür den kantianischen Rahmen.
2. Analytischer Begriffsarbeit: Er klärt präzise die Bedeutung zentraler Begriffe wie “Glaube”, “Vernunft”, “Wissen” und “Hoffnung”.
3. Wissenschaftlichem Realismus: Er nimmt die von den Naturwissenschaften beschriebene Welt als real und sucht nach Kohärenz zwischen dem wissenschaftlichen Weltbild und einer theologischen Deutung.
Durch diese methodische Trias gelingt es Tetens, sich sowohl von der prä-kritischen Metaphysik als auch vom post-kantianischen Idealismus abzusetzen (Stapleford, 2014). Sein Fundament ist modern: Es akzeptiert die Grenzen der Vernunft, die Kant aufgezeigt hat, besteht aber gleichzeitig auf einer realistischen Ontologie, die den Dialog mit den empirischen Wissenschaften ermöglicht. Auf dieser Grundlage kann er im Folgenden zu seinem eigentlichen Kernargument vorstoßen: dem moralisch-existentiellen Argument für einen vernünftigen Glauben an Gott.
3. Die Analyse der zentralen Gottesargumente
Im Zentrum von Holm Tetens’ Werk “Gott denken” steht eine dezidierte Abkehr von den traditionellen metaphysischen Gottesbeweisen hin zu einer Argumentationsform, die existenziell und pragmatisch grundiert ist. Tetens verlagert den Schwerpunkt von der logischen Deduktion einer göttlichen Existenz aus abstrakten Prinzipien auf die Frage nach der rationalen Vertretbarkeit des Glaubens angesichts der menschlichen Existenz. Diese Wende ist nicht nur eine methodische, sondern auch eine inhaltliche Neuausrichtung, die das Gottesargument im Horizont moderner, post-kantianischer Philosophie neu zu verorten sucht. Anstatt zu fragen: “Kann die Existenz Gottes bewiesen werden?”, lautet die leitende Fragestellung bei Tetens: “Ist es vernünftig, an Gott zu glauben und auf ihn zu hoffen?”. Die folgenden Abschnitte analysieren die Struktur dieses zentralen Arguments, seine pragmatische Ausrichtung und seine Verankerung in der kantianischen Tradition.
3.1 Das moralisch-existentielle Argument als Kernstück
Den Kern von Tetens’ rationaler Theologie bildet das moralisch-existentielle Argument. Dieses Argument entspringt der Einsicht, dass die großen ontologischen, kosmologischen und teleologischen Gottesbeweise in ihrer klassischen Form durch die Kritik von Hume und insbesondere Kant nachhaltig erschüttert wurden. Tetens unternimmt nicht den Versuch, diese Beweise zu rehabilitieren. Stattdessen entwickelt er einen Gedankengang, der nicht bei der Welt oder dem Seinsbegriff ansetzt, sondern bei der conditio humana – der menschlichen Verfasstheit, die durch das Bewusstsein von Moralität, Endlichkeit und dem Wunsch nach einem sinnvollen Leben gekennzeichnet ist. Das Argument ist “moralisch”, weil es von der Realität moralischer Verpflichtung und dem Streben nach dem Guten ausgeht. Es ist “existentiell”, weil es diese moralische Dimension mit den fundamentalen Fragen nach dem Sinn der eigenen Existenz, dem Umgang mit Leid und der Hoffnung über den Tod hinaus verknüpft.
Die Grundstruktur des Arguments lässt sich als eine Kette von wohlüberlegten Annahmen und Schlussfolgerungen rekonstruieren, die nicht auf zwingende Logik, sondern auf rationale Plausibilität abzielt. Tetens argumentiert, dass ein Leben, das sich konsequent an moralischen Werten orientiert, eine tiefe menschliche Sehnsucht nach einer gerechten und sinnvollen Weltordnung widerspiegelt. Diese Sehnsucht ist jedoch permanent durch die Erfahrung von Ungerechtigkeit, Leid und der scheinbaren Sinnlosigkeit des Todes bedroht. Ein rein naturalistisches Weltbild, in dem das Universum auf blinden, unpersönlichen Naturgesetzen beruht, kann dieser Sehnsucht keine Erfüllung oder auch nur eine vernünftige Grundlage bieten. Im Gegenteil: Aus naturalistischer Sicht erscheint die menschliche Moralität als ein evolutionäres Nebenprodukt und das Streben nach ultimativem Sinn als eine Illusion.
An diesem Punkt setzt Tetens’ entscheidende Überlegung ein: Die Annahme der Existenz eines Gottes, der sowohl Urgrund der moralischen Ordnung als auch Garant für die letztendliche Sinnhaftigkeit der Existenz ist, bietet eine kohärente Antwort auf dieses existentielle Dilemma. Der Glaube an Gott ermöglicht es, die moralische Anstrengung des Menschen nicht als absurd, sondern als in der fundamentalen Struktur der Realität verankert zu sehen. Gemäß dieser Argumentation liefert der Theismus einen Erklärungsrahmen, in dem die tiefsten menschlichen Intuitionen über Gut und Böse, Sinn und Hoffnung nicht als Täuschungen abgetan werden müssen. Vielmehr gibt es nach Tetens gute Gründe anzunehmen, dass ein Gott existiert, der diese moralische und existentielle Ordnung verbürgt (Gasser, 2017). Damit wird die Gottesfrage zu einer Frage nach der besten Erklärung für die Gesamtheit der menschlichen Erfahrung, insbesondere der moralischen und existentiellen Dimensionen, die in einem rein materialistischen Weltbild unerklärt oder gar widersprüchlich bleiben.
3.2 Die pragmatische Wende: Vernünftige Hoffnung statt beweisender Logik
Die entscheidende methodische Innovation in Tetens’ Argumentation ist die “pragmatische Wende”. Tetens beansprucht nicht, die Existenz Gottes zu beweisen, sondern die Rationalität des Glaubens an Gott aufzuzeigen (Mocker, 2017). Dieser Ansatz verschiebt die Beweislast: Es geht nicht mehr darum, ob die Aussage “Gott existiert” wahr ist, sondern darum, ob es für eine Person vernünftig ist, diese Aussage für wahr zu halten. Die Rechtfertigung des Glaubens wird damit zu einer praktischen, an den Konsequenzen für ein vernünftiges und sinnvolles Leben orientierten Angelegenheit. In dieser Hinsicht distanziert sich Tetens deutlich von einer Tradition, die Glauben als eine Form des Wissens (fides qua creditur) missversteht und ihn mit den Mitteln der theoretischen Vernunft beweisen will.
Diese pragmatische Argumentation ist sorgfältig von bloßem Wunschdenken abzugrenzen. Während Wunschdenken darin besteht, etwas zu glauben, weil man sich wünscht, es wäre wahr, basiert Tetens’ Konzept der “vernünftigen Hoffnung” auf einer rationalen Abwägung. Die Hoffnung auf Gott ist “vernünftig”, weil sie eine kohärente und lebenspraktisch tragfähige Deutung der Wirklichkeit ermöglicht, die im Einklang mit unseren tiefsten moralischen Überzeugungen steht. Der Glaube an Gott wird so zu einer Art Wette, ähnlich der von Pascal, jedoch mit einem entscheidenden Unterschied: Während Pascals Wette primär auf einem Kalkül des persönlichen Nutzens (Vermeidung der Hölle, Gewinn des ewigen Lebens) basiert, ist Tetens’ Argument stärker auf die Ermöglichung eines moralisch integren und sinnvollen Lebens im Hier und Jetzt ausgerichtet. Der Glaube an Gott ist nicht nur nützlich, sondern er erweist sich als rational, weil er die Bedingungen der Möglichkeit eines konsequent moralischen Lebens sichert (Gasser, 2017).
Die Stärke dieses Ansatzes liegt in seiner Immunität gegenüber der klassischen Beweiskritik. Da kein logisch zwingender Beweis angestrebt wird, können Einwände, die sich auf logische Lücken oder unbewiesene metaphysische Prämissen stützen, ins Leere laufen. Tetens argumentiert gewissermaßen aus einer empiristischen Perspektive auf die menschliche Erfahrung: Er nimmt die erlebte Realität moralischer Verpflichtung und existentieller Sehnsüchte als Ausgangspunkt, als eine Art “empirische Abstraktion” aus dem gelebten Leben (Kitcher, 2011). Anstatt von einem abstrakten Gottesbegriff auszugehen, beginnt er bei den konkreten Bedingungen des menschlichen Daseins und fragt, welche Weltsicht diesen am besten gerecht wird. Die theistische Hypothese erweist sich in diesem Vergleich als die rational überlegene Option, nicht weil sie bewiesen werden kann, sondern weil sie ein Maximum an Kohärenz zwischen unserer rationalen, moralischen und emotionalen Verfasstheit herstellt. Der Glaube wird so zu einem Akt der praktischen Vernunft, zu einer Entscheidung für diejenige Weltsicht, die ein Leben im Zeichen der Hoffnung und des Sinns rational erlaubt.
3.3 Die Kantianische Perspektive und ihre Grenzen
Die philosophischen Wurzeln von Tetens’ moralisch-existentiellem und pragmatischem Argument liegen unverkennbar bei Immanuel Kant. Tetens’ Ansatz kann als eine moderne Ausarbeitung und Aktualisierung von Kants Postulatenlehre aus der “Kritik der praktischen Vernunft” verstanden werden. Kant hatte argumentiert, dass die Existenz Gottes, zusammen mit der Unsterblichkeit der Seele und der Freiheit des Willens, zwar nicht durch die theoretische Vernunft bewiesen, aber als notwendige Bedingung für die Möglichkeit des “höchsten Guts” – der Vereinigung von Tugend und Glückseligkeit – postuliert werden muss. Für Kant ist der Glaube an Gott ein “Vernunftglaube”, der aus einem praktischen Bedürfnis der Moral entspringt. Tetens greift diese Grundidee auf: Der Glaube an Gott ist rational, weil er für die Kohärenz des moralischen Unternehmens notwendig ist (Mocker, 2017).
Tetens folgt Kant in der strikten Trennung von theoretischem Wissen und praktischem Glauben. Gott ist kein Gegenstand der Erkenntnis, sondern ein Fokus der Hoffnung und eine Bedingung für die Sinnhaftigkeit moralischen Handelns. Die pragmatische Argumentation bei Tetens spiegelt Kants Überzeugung wider, dass die Vernunft ein Interesse daran hat, die Welt als einen Ort zu denken, an dem moralisches Handeln nicht letztlich absurd ist. Indem Tetens jedoch den Akzent stärker auf die existentielle Dimension legt – die persönliche Suche nach Sinn, Trost und Hoffnung –, erweitert er die eher formale kantianische Struktur um eine lebensweltliche Komponente. Es geht nicht nur um die logische Konsistenz der Moral, sondern um die gelebte Erfahrung eines endlichen Wesens, das nach einem übergeordneten Sinn fragt.
Trotz der starken Anlehnung an Kant weist Tetens’ Argumentation auch Schwachstellen auf, die in der philosophischen Diskussion kritisch beleuchtet werden (Mocker, 2017). Ein zentraler Einwand betrifft die Frage, ob die Hoffnung wirklich “vernünftig” ist oder ob sie nicht doch eine Form von sublimiertem Wunschdenken bleibt. Die Tatsache, dass der Glaube an Gott psychologisch tröstlich oder moralisch motivierend ist, beweist noch nicht seine rationale Vertretbarkeit. Kritiker könnten argumentieren, dass die Annahme Gottes lediglich eine Ad-hoc-Hypothese ist, um eine unangenehme Konsequenz des Naturalismus (die potentielle Sinnlosigkeit) zu vermeiden. Die pragmatische Rechtfertigung droht zirkulär zu werden: Man glaubt, weil der Glaube nützlich ist, um einen Zustand (Sinnhaftigkeit) zu erreichen, dessen Realität man erst durch den Glauben postuliert.
Eine weitere Grenze des Ansatzes liegt in seiner Abhängigkeit von bestimmten subjektiven Voraussetzungen. Das Argument entfaltet seine volle Überzeugungskraft nur für Personen, die die Prämisse einer objektiven Moral und die Dringlichkeit der Sinnfrage bereits akzeptieren. Für einen konsequenten Skeptiker oder Nihilisten, der moralische Werte als rein subjektive Präferenzen und die Sinnfrage als gegenstandslos betrachtet, verliert das Argument seine Grundlage. Tetens scheint auf eine Form der Selbsterkenntnis zu setzen, bei der das Individuum die Unausweichlichkeit dieser moralisch-existentiellen Fragen in seinem eigenen Leben anerkennt. Er scheint bewusst auf einen Appell an eine übernatürliche “Macht Gottes” zu verzichten und stattdessen auf die Überzeugungskraft der inneren, rationalen Reflexion zu setzen (Kitcher, 2011). Letztlich bleibt die Frage offen, ob der Sprung von der menschlichen Sehnsucht nach Sinn zur Annahme eines Gottes, der diesen Sinn garantiert, rational zwingender ist als die alternative Schlussfolgerung, dass die menschliche Sehnsucht in einem indifferenten Universum möglicherweise unerfüllt bleibt.
4. Spezifische Aspekte der Theologie und Metaphysik
Aufbauend auf seinem moralisch-existentiellen Gottesargument entfaltet Holm Tetens eine Reihe von spezifischen theologischen und metaphysischen Konzeptionen, die seinen Gottesbegriff weiter präzisieren. Diese Überlegungen sind keine losgelösten Spekulationen, sondern logische Konsequenzen seines rationalen Ansatzes. Wenn Gott als Garant der moralischen und rationalen Weltordnung gedacht wird, muss sich dies auch in der Konzeption seiner Beziehung zur Welt, zu den Naturgesetzen und zum menschlichen Handeln niederschlagen. Tetens’ Theologie zielt darauf ab, einen Gottesbegriff zu entwickeln, der mit einem modernen, wissenschaftlichen Weltbild kompatibel ist und gleichzeitig die für den Glauben zentralen Aspekte wie Schöpfung, göttliche Gegenwart und die Realität von Sünde und Erlösung sinnvoll deuten kann.
4.1 Gott als Schöpfer der Naturgesetze
In der Auseinandersetzung mit der Beziehung zwischen Gott und der Welt rückt Tetens das Konzept Gottes als Schöpfer der Naturgesetze in den Vordergrund (Müller, 2017). Dieser Ansatz vermeidet die Vorstellung eines interventionistischen Gottes, der willkürlich in das Weltgeschehen eingreift und die von ihm selbst geschaffenen Gesetze durchbricht. Ein solcher Gott der “Lücken” wäre mit einem wissenschaftlichen Verständnis der Welt, das auf der Annahme einer durchgängigen kausalen Ordnung beruht, kaum vereinbar. Stattdessen konzipiert Tetens Gott als den transzendenten Grund der rationalen Struktur und Ordnung des Universums selbst. Gottes Schöpferhandeln manifestiert sich nicht in Wundern, die die Naturgesetze verletzen, sondern in der Existenz dieser Gesetze. Die mathematische Eleganz, die universelle Gültigkeit und die Erkennbarkeit der Naturgesetze sind für Tetens ein Hinweis auf einen rationalen Urheber.
Diese Perspektive löst den vermeintlichen Konflikt zwischen Wissenschaft und Glaube auf, indem sie ihnen unterschiedliche, aber komplementäre Ebenen der Erklärung zuweist. Die Naturwissenschaften fragen nach dem “Wie” – sie beschreiben die innerweltlichen Mechanismen und gesetzmäßigen Zusammenhänge. Die rationale Theologie fragt nach dem “Warum” – sie thematisiert den ontologischen Grund für die Existenz einer solchen geordneten und gesetzmäßigen Welt. Gott ist in diesem Modell nicht eine weitere Ursache innerhalb der Kausalkette der Welt, sondern die absolute Bedingung der Möglichkeit der gesamten kontingenten Weltordnung (Müller, 2017). Er ist die Antwort auf die leibnizsche Frage: “Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?” und präziser: “Warum ist die Welt so geordnet und rational verfasst, dass wir sie verstehen können?”. Damit wird die wissenschaftliche Rationalität nicht als Bedrohung, sondern als Bestätigung eines Glaubens an einen Gott der Ordnung und Vernunft gedeutet.
4.2 Die Beziehung zwischen Gott und Welt: Panentheistische Deutungen
Um die intime Beziehung zwischen dem transzendenten Schöpfer und der immanenten Welt zu fassen, greift Tetens auf Denkfiguren zurück, die starken panentheistischen Zügen entsprechen. Der Panentheismus (griechisch: “pan-en-theos” – alles in Gott) ist die Lehre, dass die Welt in Gott existiert, Gott aber gleichzeitig die Welt transzendiert und mehr ist als sie. Dieses Modell unterscheidet sich sowohl vom Theismus (Gott und Welt sind radikal getrennt) als auch vom Pantheismus (Gott und Welt sind identisch). Für Tetens bietet der Panentheismus einen attraktiven Rahmen, um die beständige Gegenwart Gottes in der Welt zu denken, ohne ihn mit der Welt gleichzusetzen. So wird die These, dass “alles in Gott ist”, zu einem zentralen Punkt seiner Überlegungen (Göcke, 2017).
In dieser panentheistischen Perspektive ist die Welt nicht nur ein von Gott geschaffenes Artefakt, das nun unabhängig von ihm existiert. Vielmehr ist die Welt der Ort, an dem sich Gottes rationales Denken und sein schöpferischer Wille manifestieren. Die Realität kann als Inhalt vernünftiger göttlicher Gedanken verstanden werden, was die tiefe Rationalität und Erkennbarkeit des Kosmos erklärt (Göcke, 2017). Die Beziehung ist eine des wechselseitigen Umgreifens: Die Welt ist in Gott als ihrem ontologischen Grund enthalten, während Gott die Welt durchdringt und erhält. Dieses Modell ermöglicht es, Gott als persönlich und der Welt zugewandt zu verstehen, ohne in anthropomorphe Vorstellungen eines außerweltlichen Akteurs zu verfallen. Gottes Wirken ist nicht punktuell, sondern universal und kontinuierlich – es ist die beständige Aufrechterhaltung der Seins- und Ordnungsstrukturen, die die Welt konstituieren. Die Annahme eines solchen Gotteskonzepts erlaubt es, die religiösen Intuitionen von göttlicher Nähe und Allgegenwart philosophisch zu artikulieren, ohne die Autonomie der geschaffenen Welt und ihrer Eigengesetzlichkeit zu negieren.
4.3 Implikationen für das Verständnis von Sünde und göttlichem Handeln
Die panentheistische Metaphysik und die Konzeption Gottes als Grund der rationalen Ordnung haben tiefgreifende Implikationen für klassische theologische Lehren wie Sünde und göttliches Handeln. In Tetens’ Denken wird “Sünde” nicht primär als juristischer Verstoß gegen einen von außen auferlegten göttlichen Gesetzescodex verstanden. Vielmehr erhält sie eine ontologische Dimension: Sünde ist die bewusste Abkehr von der rationalen und moralischen Ordnung, die in der Struktur der Wirklichkeit selbst und damit in Gott gründet. Sie ist eine Form der Selbstentfremdung des Menschen von seinem eigenen wahren Sein, das auf die Teilhabe an dieser göttlichen Rationalität und Moralität angelegt ist. Diese Deutung vermeidet die Vorstellung eines zürnenden, strafenden Gottes und interpretiert die negativen Konsequenzen der Sünde als die immanenten Folgen einer Handlung, die gegen die eigene Natur und die Seinsordnung gerichtet ist.
Entsprechend wird auch das “göttliche Handeln” neu konzipiert. Anstatt von “besonderen göttlichen Handlungen” (special divine actions) im Sinne von Wundern oder spezifischen Eingriffen auszugehen, legt das Modell von Tetens eine Betonung auf das universale, allgemeine Handeln Gottes. Göttliches Handeln ist primär das kontinuierliche Schaffen und Erhalten der Welt und ihrer rationalen Strukturen. Es ist ein Handeln, das dem Menschen Freiheit ermöglicht, anstatt sie zu unterlaufen. Ein Appell an die “Macht Gottes” im Sinne einer willkürlichen Intervention wird vermieden (Kitcher, 2011). Erlösung und göttliche Hilfe manifestieren sich dann nicht in der Durchbrechung der Naturordnung, sondern in der Ermöglichung von Einsicht, moralischer Umkehr und der Erfahrung von Sinn innerhalb dieser Ordnung. Dieses Konzept birgt jedoch auch aporien, die Tetens’ Ansatz als problematisch erscheinen lassen können: Wenn alles “in Gott” ist und von seiner rationalen Ordnung durchdrungen wird, wie lässt sich dann die radikale Realität des Bösen und des Leidens erklären? Und wie kann die Freiheit des Menschen, sich gegen diese Ordnung zu stellen, gedacht werden, ohne die Allgegenwart und Wirksamkeit Gottes zu kompromittieren? Diese “problematischen Punkte” zeigen, dass Tetens’ rationalisierte Theologie zwar an Kohärenz gewinnt, sich aber neuen, anspruchsvollen philosophischen Herausforderungen stellen muss (Göcke, 2017).
5. Kritische Einordnung und philosophischer Diskurs
Holm Tetens’ Werk “Gott denken” positioniert sich bewusst in einem Spannungsfeld, das durch Jahrhunderte philosophischer Debatten geprägt ist. Seine Verteidigung einer “Rationalen Theologie” ist kein naiver Rückfall in vorkritische Dogmatik, sondern ein durchdachter Versuch, die Möglichkeit eines vernünftigen Redens über Gott nach den Zäsuren der Aufklärung und der sprachanalytischen Wende neu zu justieren. Eine kritische Einordnung erfordert daher die Auseinandersetzung mit der historischen Kritik an metaphysischen Gottesbeweisen, eine genaue Bewertung der Stärke seines zentralen pragmatischen Arguments sowie die Verortung seiner Position im Gefüge der zeitgenössischen Religionsphilosophie. Tetens’ Ansatz, der kantianische Motive mit analytischer Methodik verbindet, stellt einen bemerkenswerten, aber auch angreifbaren Beitrag zum modernen Diskurs dar.
5.1 Auseinandersetzung mit der Kritik an der Rationalen Theologie (Hume, Kant)
Die traditionelle rationale Theologie sah sich spätestens seit dem 18. Jahrhundert zwei fundamentalen Kritiken ausgesetzt, die von David Hume und Immanuel Kant formuliert wurden. Humes empiristische Skepsis zielte darauf ab, die kausale Argumentation a priori zu untergraben, die für kosmologische und teleologische Gottesbeweise fundamental ist (Carl, 2021). Er argumentierte, dass unsere Kenntnis von Ursache-Wirkungs-Beziehungen auf Erfahrung beruht und nicht über die Grenzen der erfahrbaren Welt hinaus auf eine erste, transzendente Ursache extrapoliert werden kann. Kant, der durch Hume aus seinem “dogmatischen Schlummer” geweckt wurde, führte diese Kritik auf einer transzendentalphilosophischen Ebene weiter. In seiner “Kritik der reinen Vernunft” zeigte er, dass die Kategorien des Verstandes, wie Kausalität, nur auf mögliche Gegenstände der Erfahrung (Phaenomena) angewendet werden können. Versuche, sie auf die Welt als Ganzes oder auf ein transzendentes Wesen (Noumena) wie Gott anzuwenden, führen zwangsläufig zu Antinomien und Paralogismen, also zu unauflösbaren Widersprüchen der reinen Vernunft (Tomaszewska, 2022).
Tetens’ Programm einer “Rationalen Theologie” ist sich dieser vernichtenden Kritiken voll bewusst und versucht nicht, sie zu widerlegen. Stattdessen umgeht er ihre Stoßrichtung, indem er die Zielsetzung der rationalen Theologie grundlegend modifiziert. Er strebt keine beweisende, apodiktische Gewissheit über die Existenz Gottes an. Sein Projekt ist bescheidener und zugleich moderner: Es geht um die Frage, ob der Gedanke an Gott und der Glaube an seine Existenz innerhalb eines wissenschaftlich aufgeklärten Weltbildes als rational zulässig oder vernünftig vertretbar gelten können. Tetens akzeptiert die kantische Einschränkung, dass Gott kein Gegenstand theoretischen Wissens sein kann. Das Problem, ob wir Gott denken können, wird somit von einer ontologischen zu einer epistemisch-pragmatischen Fragestellung verschoben (Carl, 2021). Seine Methode ist nicht die Deduktion aus reinen Vernunftprinzipien, sondern das, was man als eine Form der “empiristischen Abstraktion” beschreiben könnte, bei der aus der Struktur unserer moralischen und existentiellen Erfahrung auf die Rationalität bestimmter Postulate geschlossen wird (Kitcher, 2011). In diesem Sinne nimmt Tetens die Kritik von Hume und Kant ernst, indem er den Geltungsanspruch der Theologie von der Ebene des beweisbaren Wissens auf die Ebene der vernünftigen Hoffnung und des praktischen Postulats verlagert.
5.2 Bewertung der Stärke von Tetens’ pragmatischer Argumentation
Das Herzstück von Tetens’ neuem Entwurf ist das moralisch-existentielle Argument, das in eine pragmatische Form gegossen wird. Seine Stärke liegt unzweifelhaft in seiner Resilienz gegenüber der klassischen Kritik an Gottesbeweisen. Indem das Argument nicht darauf abzielt, die Existenz Gottes zu beweisen, sondern die Rationalität des Glaubens an ihn zu verteidigen, entzieht es sich dem direkten Zugriff von Logikern, die nach Fehlschlüssen suchen, oder von Empiristen, die nach empirischer Evidenz verlangen. Der Fokus verschiebt sich vom Objekt (Gott) zum Subjekt (dem glaubenden, hoffenden und handelnden Menschen). Das Argument knüpft an eine tief empfundene menschliche Erfahrung an: die Sehnsucht nach einem letzten Sinn, die Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit und der moralische Imperativ, trotz der Kontingenz und des Leidens in der Welt für das Gute zu wirken. Tetens’ Argumentation, die stark von einer kantianischen Perspektive inspiriert ist, schlägt vor, dass der Glaube an einen Gott, der die moralische Weltordnung garantiert und die Hoffnung auf Vollendung stützt, eine vernünftige Haltung darstellt, um ein kohärentes und moralisch integres Leben zu führen (Mocker, 2017).
Gleichzeitig liegen in dieser pragmatischen Wende auch die wesentlichen Schwachpunkte seiner Argumentation. Kritiker können einwenden, dass der pragmatische Nutzen eines Glaubens nichts über dessen Wahrheit aussagt. Die Tatsache, dass der Glaube an Gott psychologisch tröstlich oder moralisch motivierend sein mag, beweist nicht, dass Gott existiert – ein Punkt, den Tetens selbst zugestehen würde. Die entscheidende Frage ist jedoch, ob dieser Nutzen ausreicht, um den Glauben als “rational” zu klassifizieren. Hier wird die Argumentation angreifbar. Was für den einen eine Quelle des Sinns ist, mag für den anderen eine Form der Selbsttäuschung oder ein “Opium des Volkes” sein. Die Rationalität des Glaubens scheint somit von subjektiven Prädispositionen und existentiellen Bedürfnissen abzuhängen, was ihren universellen Anspruch schwächt. Darüber hinaus wird in der Analyse von Tetens’ Argumenten auf gewisse Schwachstellen hingewiesen, die sich aus der kantischen Perspektive ergeben. Beispielsweise bleibt unklar, ob die “Hoffnung” auf eine von Gott garantierte moralische Ordnung eine hinreichend starke rationale Basis darstellt, insbesondere wenn alternative, rein säkulare humanistische Ethiken ebenfalls kohärente Lebensentwürfe anbieten können (Mocker, 2017). Die Stärke des Arguments hängt letztlich davon ab, ob man die Prämisse akzeptiert, dass ein Leben ohne die durch den Gottesglauben gestützte Hoffnung rational unbefriedigend oder moralisch unvollständig ist.
5.3 Tetens’ Position in der zeitgenössischen analytischen Religionsphilosophie
Innerhalb der vielfältigen Strömungen der zeitgenössischen analytischen Religionsphilosophie nimmt Holm Tetens eine interessante und eigenständige Position ein. Als einflussreicher analytischer Philosoph in Deutschland verbindet er die für diese Tradition typische begriffliche Klarheit und argumentative Strenge mit Themen und Perspektiven, die stärker in der kontinentaleuropäischen, insbesondere der deutschen, Philosophie verwurzelt sind (Brüntrup, 2017). Seine Arbeit lässt sich weder dem a-theistischen Naturalismus eines Richard Dawkins noch dem anspruchsvollen an Theismus eines Alvin Plantinga oder William Lane Craig zuordnen.
Tetens’ Ansatz unterscheidet sich vom populären “New Atheism”, indem er die religiöse Fragestellung nicht als pseudowissenschaftliche Hypothese abtut, sondern ihre philosophische Tiefe und existentielle Relevanz anerkennt. Anders als viele amerikanische Theisten, die oft versuchen, Gottesbeweise mit den Mitteln der Modallogik oder der Wahrscheinlichkeitstheorie zu rehabilitieren, verzichtet Tetens auf solche direkten apologetischen Strategien. Sein Weg ist subtiler und grundlegender: Er fragt nach den Bedingungen der Möglichkeit eines vernünftigen Gottesgedankens in einer nach-metaphysischen Zeit. In dieser Hinsicht steht er der kantianischen Tradition näher als dem anglo-amerikanischen Evidentialismus.
Seine Position könnte als eine Form des “rationalen Non-Kognitivismus” oder “pragmatischen Postulationalismus” beschrieben werden. Er behandelt religiöse Sätze nicht primär als Tatsachenbehauptungen (kognitiv), sondern als Ausdruck einer rational gerechtfertigten Haltung der Hoffnung und des Vertrauens. Damit grenzt er sich auch von progressiven Theologien ab, die Gott oft in relationalen oder prozess-theologischen Kategorien als “relationalen Geist” denken, um ihn mit einer dynamischen Welt in Einklang zu bringen (Dorrien, 2012). Tetens’ Gottesbild bleibt klassischer und metaphysisch “dünner”; es ist primär die notwendige Bedingung für die Möglichkeit einer rationalen moralischen Hoffnung. Seine Arbeit stellt somit einen wichtigen Versuch dar, eine Brücke zwischen der analytischen Methodik und dem Erbe der deutschen Aufklärung zu schlagen und einen eigenständigen, dritten Weg zwischen dogmatischem Theismus und reduktionistischem Atheismus zu beschreiten.
6. Schlussfolgerung
Holm Tetens’ Werk “Gott denken” stellt einen intellektuell anspruchsvollen und philosophisch bedeutsamen Beitrag zur modernen Religionsphilosophie dar. Es ist der Versuch, nach der umfassenden Kritik an der traditionellen Metaphysik durch Hume und Kant einen rational gangbaren Weg für das Denken über Gott aufzuzeigen. Diese Arbeit hat die zentralen Argumentationslinien und philosophischen Positionen von Tetens’ Entwurf nachgezeichnet, von der Neudefinition der “Rationalen Theologie” über die Analyse seines moralisch-existentiellen Arguments bis hin zu den metaphysischen Implikationen für das Verständnis der Welt. Die Analyse hat gezeigt, dass Tetens’ Projekt nicht in einer Wiederbelebung überholter Gottesbeweise besteht, sondern in einer grundlegenden Neuausrichtung der Fragestellung: weg von der ontologischen Gewissheit hin zur rationalen Vertretbarkeit des Glaubens als eine Form vernünftiger Hoffnung.
Die zentrale These, die sich aus der Auseinandersetzung mit Tetens’ Buch ergibt, ist, dass er eine post-kritische rationale Theologie entwirft, die ihre eigene aporieanfälligkeit reflektiert und gerade dadurch an philosophischer Plausibilität gewinnt. Tetens’ Ansatz ist zutiefst kantianisch geprägt, indem er die Grenzen der theoretischen Vernunft anerkennt und den Gottesgedanken im Bereich der praktischen Vernunft verortet. Sein Kernargument ist pragmatischer Natur: Der Glaube an Gott wird nicht als beweisbare Wahrheit, sondern als rationale Voraussetzung für ein kohärent-sinnvolles und moralisch orientiertes Leben verteidigt (Mocker, 2017). Dieses Argument schöpft seine Kraft aus der existenziellen Erfahrung des Menschen, der nach Sinn, Gerechtigkeit und einer übergeordneten Ordnung sucht. Gott wird so zu einem Postulat, das es dem Menschen erlaubt, die Welt und sein eigenes Handeln darin als Teil eines vernünftigen Ganzen zu begreifen, in dem letztlich nichts geschieht, was nicht dem vernünftigen Denken Gottes zustimmen würde (Tetens, 2017).
Die Stärke von Tetens’ Position liegt in ihrer intellektuellen Redlichkeit. Er verspricht keine einfachen Antworten, sondern vollzieht eine präzise philosophische Gratwanderung. Er vermeidet sowohl den dogmatischen Theismus, der die Kritik der Aufklärung ignoriert, als auch einen reduktionistischen Atheismus, der die Tiefe der religiösen Frage verkennt. Sein als analytischer Philosoph geschulter Scharfsinn ermöglicht ihm, die komplexen begrifflichen und argumentativen Strukturen, die dem Gottesgedanken zugrunde liegen, klar und differenziert zu analysieren (Brüntrup, 2017). Dennoch ist sein Ansatz nicht frei von Schwächen. Die pragmatische Argumentation beruht auf der Prämisse, dass ein Leben ohne die Hoffnung auf eine göttliche Ordnung rational unbefriedigend ist – eine Annahme, die nicht universell geteilt werden muss. Die Rationalität des Glaubens bleibt somit an eine subjektive, existentielle Entscheidung gebunden, was die intersubjektive Überzeugungskraft des Arguments begrenzt.
Abschließend lässt sich festhalten, dass Holm Tetens mit “Gott denken” keine neue, für alle verbindliche Antwort auf die Gottesfrage liefert, sondern vielmehr den Raum für eine rationale Auseinandersetzung mit dieser Frage neu vermisst und erweitert. Sein Werk ist ein eindringliches Plädoyer dafür, die Frage nach Gott nicht aus dem philosophischen Diskurs auszugrenzen, sondern sie mit der größtmöglichen intellektuellen Strenge und Aufrichtigkeit zu behandeln. Tetens’ Beitrag liegt darin, gezeigt zu haben, wie ein Denken über Gott aussehen kann, das sowohl dem wissenschaftlichen Weltbild der Moderne als auch den tiefsten existenziellen Bedürfnissen des Menschen gerecht zu werden versucht. Seine Arbeit ist somit weniger eine Apologie des Glaubens als vielmehr eine Verteidigung der Rationalität, sich mit der Möglichkeit Gottes philosophisch auseinanderzusetzen. Sie fordert Gläubige wie Nicht-Gläubige gleichermaßen heraus, ihre Positionen zu reflektieren und zu begründen, und bekräftigt damit die unaufgebbare Relevanz der Religionsphilosophie für das menschliche Selbstverständnis.
References
Brüntrup, G., 2017. „Special Focus on Holm Tetens’s ‚Thinking God ‘(‚Gott denken ‘)“. https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/nzsth-2017-0026/html
Gasser, G., 2017. Holm Tetens on the moral-existential argument for theism: reasonable hope and wishful thinking. https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/nzsth-2017-0029/html
Tetens, H., 2017. An Outline of a Rational Theology. https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/nzsth-2017-0031/html
Carl, W., 2021. Abraham Anderson, Kant, Hume, and the Interruption of Dogmatic Slumber Oxford: Oxford University Press, 2020 Pp. xxii+ 180 ISBN 9780190096748 (hbk)£ 47.99. Kantian Review. https://www.cambridge.org/core/journals/kantian-review/article/abraham-anderson-kant-hume-and-the-interruption-of-dogmatic-slumber-oxford-oxford-university-press-2020-pp-xxii-180-isbn-9780190096748-hbk-4799/7F3C7FE1813A09773DC060681294CEB5
O’Shea, J., 2011. Kant’s critique of pure reason: an introduction. taylorfrancis.com. https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315730097/kant-critique-pure-reason-james-shea
Tomaszewska, A., 2022. Kant’s Rational Religion and the Radical Enlightenment. torrossa.com. https://www.torrossa.com/it/resources/an/5262476
Creek, R., 2018. Kant and Tetens on Transcendental Philosophy. search.proquest.com. https://search.proquest.com/openview/6e37edcc9556bc4a5f687f9f5981e9f6/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
Eberhard, J., 2016. Preparation for natural theology: With Kant’s notes and the Danzig rational theology transcript. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=E04UCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Tetens+God+thought+chapter+overview,+arguments+rational+theology&ots=h8KfAU1yit&sig=Z1Ij4h6gm7TEpCLxjuQRFLVKkWc
Dyck, C., 2014. Kant and rational psychology. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=BWPwAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Tetens+God+thought+chapter+overview,+arguments+rational+theology&ots=UTmz143Vh2&sig=zXIPa_CVU1m0ctPr_hM-BwpN0XI
Stapleford, S., 2014. Tetens’ Refutation of Idealism and Properly Basic Belief. philarchive.org. https://philarchive.org/archive/STATRO-28
Mocker, C., 2017. Holm Tetens on the Moral Argument for Theism: A Kantian Perspective. https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/nzsth-2017-0030/html
Kitcher, P., 2011. Kant’s thinker. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=XDhsAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=Tetens+God+thought+chapter+overview,+arguments+rational+theology&ots=LZ470yT7If&sig=DH3sxQuRo_0g_BsGr07mTrrC3FE
Müller, T., 2017. God as Creator of Natural Laws: On the Relation of the Absolute and the Contingent World. https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/nzsth-2017-0027/html
Göcke, B. & Jaskolla, L., 2017. Holm Tetens on Panentheism: The Concept of Panentheism, Sin, and Special Divine Action. https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/nzsth-2017-0028/html
Dorrien, G., 2012. Kantian reason and Hegelian spirit: The idealistic logic of modern theology. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=B8JJYOysH9EC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Tetens+God+thought+chapter+overview,+arguments+rational+theology&ots=lYODzZdTNf&sig=qtDbGDvOeVN9oRbiRRVOZckiepQ